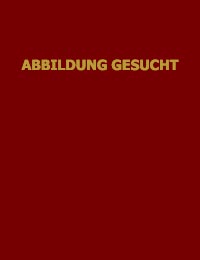Infanterie-Gewehre vor 1713 |
|

"Henoul-Gewehre" um 1705 mit Spund-Bajonett, darüber Lunten-Berger (Montage)
|
|
| Vorläufer: |
keine klassifizierbaren Angaben |
Nachfolger: |
 Infanterie-Gewehr Modell 1713 Infanterie-Gewehr Modell 1713
|
Ein typisches Gewehr-Modell für die brandenburgisch-preussische
 Infanterie auszumachen, dass in der Zeit des Kurfürsten
Infanterie auszumachen, dass in der Zeit des Kurfürsten
 Friedrich III. (1657 – 1713, besser bekannt als Friedrich I.; der erste König "in Preussen") als Standard für die
Friedrich III. (1657 – 1713, besser bekannt als Friedrich I.; der erste König "in Preussen") als Standard für die
 Bewaffnung klassifiziert werden kann, ist nicht möglich: Sämtliche
Bewaffnung klassifiziert werden kann, ist nicht möglich: Sämtliche
 Feuer-Waffen wurden in dieser Epoche nach recht vagen Vorgaben oder nach gegebenem Angebot in verhältnismäßig geringer Auflage in kleinen Manufakturen gefertigt, gekauft oder von Zwischen-Händlern angeboten, die sich auf die
Feuer-Waffen wurden in dieser Epoche nach recht vagen Vorgaben oder nach gegebenem Angebot in verhältnismäßig geringer Auflage in kleinen Manufakturen gefertigt, gekauft oder von Zwischen-Händlern angeboten, die sich auf die  Ausrüstung der Ausrüstung der  Armeen spezialisiert hatten. In der Regel wurden diese Kaufleute vom jeweiligen Armeen spezialisiert hatten. In der Regel wurden diese Kaufleute vom jeweiligen
 Inhaber eines
Inhaber eines  Regiments beauftragt, eine bestimmte Anzahl von Regiments beauftragt, eine bestimmte Anzahl von  Waffen zu einem vorher fixierten Preis zu beschaffen (siehe dazu Waffen zu einem vorher fixierten Preis zu beschaffen (siehe dazu
 Kompanie-Wirtschaft). Ihren "Schnitt" machten diese Kaufleute mit der Handels-Spanne, die zwischen dem mit Rabatten verbundenen Ankauf der Gewehre "en gros" vor Ort und dem Verkauf der Waffen an den Auftrag-Geber auszuhandeln war. Der interne Handel unter den einzelnen Regiments-Inhabern, regelmäßige Nach- und Verkäufe gebrauchter oder neuwertiger Stücke hatten jedoch zur Folge, dass die
Kompanie-Wirtschaft). Ihren "Schnitt" machten diese Kaufleute mit der Handels-Spanne, die zwischen dem mit Rabatten verbundenen Ankauf der Gewehre "en gros" vor Ort und dem Verkauf der Waffen an den Auftrag-Geber auszuhandeln war. Der interne Handel unter den einzelnen Regiments-Inhabern, regelmäßige Nach- und Verkäufe gebrauchter oder neuwertiger Stücke hatten jedoch zur Folge, dass die
 Arsenale in den
Arsenale in den
 Festungen und die Depots der Regimenter alsbald mit einem Durcheinander verschiedenster Waffen, Typen und Kaliber strotzten. Für Reparaturen bzw. Instand-Setzungen griffen die ansässigen Uhrmacher oder die regiments-eigenen Schlosser auf einen Fundus von Ersatz-Teilen unterschiedlichster Modelle zurück, was das währende Durcheinander noch mehrte. Auch musste für beinahe jede Muskete die entsprechende
Festungen und die Depots der Regimenter alsbald mit einem Durcheinander verschiedenster Waffen, Typen und Kaliber strotzten. Für Reparaturen bzw. Instand-Setzungen griffen die ansässigen Uhrmacher oder die regiments-eigenen Schlosser auf einen Fundus von Ersatz-Teilen unterschiedlichster Modelle zurück, was das währende Durcheinander noch mehrte. Auch musste für beinahe jede Muskete die entsprechende
 Munition von den Feuerwerkern maßgefertigt werden. Missstände, die erst
Munition von den Feuerwerkern maßgefertigt werden. Missstände, die erst  Friedrich Wilhelm I. (1688 – 1740, besser bekannt als der "Soldatenkönig") mittels Verfügung einheitlicher Vorgaben im Jahr 1713 einzudämmen suchte. Friedrich Wilhelm I. (1688 – 1740, besser bekannt als der "Soldatenkönig") mittels Verfügung einheitlicher Vorgaben im Jahr 1713 einzudämmen suchte.
Bis dahin kamen Waffen im wahrsten Sinne aus "aller Herren Länder" - vorzugsweise aus den 1670 gegründeten und zwischenzeitlich etablierten Waffen-Schmieden des Meisters Henoul im Fürst-Bistum von Lüttich (heute Liège; Belgien), gefolgt von den talentierten Werk-Stätten der "Suhler Innung" und den Maastrichter Manufakturen von Jean Jacob Behr und Jan Krans. Umstände, die eine eindeutige Bestimmung bzw. Klassifizierung und dementsprechend historisch-korrekte Zuordnung von möglichen bzw. erklärten "Original-Waffen" der frühen
 brandenburgisch-preussischen Armee so gut wie unmöglich machen.
brandenburgisch-preussischen Armee so gut wie unmöglich machen.
~
|
Abmessungen, Angaben und Beschreibungen zu Modellen aus dieser Zeit variieren auf Grund der Vielzahl von Typen in der Art, dass vergleichende Daten hier zu weit führen würden.
|
| Hersteller-Angaben |
| Entwickler: |
diverse |
| Hersteller (Manufakturen): |
diverse |
| Produktionszeit: |
bis 1713 |
| produzierte Stückzahl: |
keine Angaben |
| Verbreitung: |
europa-weit
|
| Kategorisierung (allg.): |
siehe  Muskete Muskete
|
| Segmentierung |
| Gruppe: |
Vorder-Lader |
| Bereich: |
Nahbereichs-Waffe |
| Reichweite (effektiv): |
75 bis 150 m (max. 300 m) |
| Sektion: |
glattläufige, flintenartige (Gewehre) |
| Art: |
Muskete |
| System: |
Steinschloss-Zünder |
| Kadenz: |
2 bis 3 Schuss pro Minute |
| Typ: |
Infanterie-Gewehr |
| Modell: |
diverse
|
| technische Angaben |
| Gesamt-Länge: |
um 1.500 bis 1.800 mm |
| Lauf-Länge: |
um 1.000 bis 1.500 mm |
| Lauf-Befestigung: |
Stifte und/oder Ringe |
| Kaliber: |
zwischen 15 und 20 mm |
| Gewicht: |
zwischen 4 bis 6 kg
|
| Ansichts-Exemplare |
| Sammlung: |
 "Livrustkammaren"; Stockholm, Schweden "Livrustkammaren"; Stockholm, Schweden
 Burg Forchtenstein; Burgenland; Österreich Burg Forchtenstein; Burgenland; Österreich
 Kreismuseum Fürstenwalde Kreismuseum Fürstenwalde
|
|

Detail-Ansicht: Steinschloss einer zu Lüttich gefertigten Muskete
|
... zu den  neupreussischen Feuer-Waffen (nach 1806 bis 1870) neupreussischen Feuer-Waffen (nach 1806 bis 1870)
... zurück zur  Übersicht preussische Feuer-Waffen Übersicht preussische Feuer-Waffen
... zurück zum  KOMPENDIUM der Waffenkunde - Verzeichnis KOMPENDIUM der Waffenkunde - Verzeichnis
|
|
|
Infanterie-Gewehr M 1713 (s.g. "Henoul-Flinten") |
|

"Henoul-Flinte", gefertigt vom "Besten schwedischen Stahl" (Montage; nicht original der eiserne Ladestock, der erst ab 1718 eingeführt wurde)
|
|
| Vorläufer: |
 diverse Typen und Modelle vor 1713 diverse Typen und Modelle vor 1713
|
Nachfolger: |
 Infanterie-Gewehr Modell 1723 Infanterie-Gewehr Modell 1723
|
Seit Ende des 17. Jahrhunderts bezog die
 brandenburgisch-preussische Armee
brandenburgisch-preussische Armee
 Feuer-Waffen bevorzugt aus den etablierten belgisch-niederländischen Büchsenmacher-Werkstätten in Namur, Maastricht und dem nahen Lüttich (heute Liège; Belgien). Besonders ausgeprägte Handels-Beziehungen bestanden spätestens seit 1708 zu dem namhaften flämischen Meister Francois Pholien Henoul im Fürst-Bistum Lüttich. Ab 1713 - und somit gleich nach dem Regierungs-Antritt Königs
Feuer-Waffen bevorzugt aus den etablierten belgisch-niederländischen Büchsenmacher-Werkstätten in Namur, Maastricht und dem nahen Lüttich (heute Liège; Belgien). Besonders ausgeprägte Handels-Beziehungen bestanden spätestens seit 1708 zu dem namhaften flämischen Meister Francois Pholien Henoul im Fürst-Bistum Lüttich. Ab 1713 - und somit gleich nach dem Regierungs-Antritt Königs  Friedrich Wilhelm I. (1688 – 1740, besser bekannt als der "Soldatenkönig") - wurde ein Vertrag ausgehandelt, der das sogenannte, jedoch nur in wenigen Details beschriebene Friedrich Wilhelm I. (1688 – 1740, besser bekannt als der "Soldatenkönig") - wurde ein Vertrag ausgehandelt, der das sogenannte, jedoch nur in wenigen Details beschriebene
 "Henoul-Gewehre" zur
"Henoul-Gewehre" zur  Standard-Muskete für die preussische Standard-Muskete für die preussische
 Infanterie erklärte. Vertraglich vereinbart wurde, dass Lauf und Schwanzschraube, Kolbenblech, Schloss samt Feder aus "... besten schwedischen Stahl... " gefertigt werden sollten, für die s.g. Spitz-Röhrchen und das
Infanterie erklärte. Vertraglich vereinbart wurde, dass Lauf und Schwanzschraube, Kolbenblech, Schloss samt Feder aus "... besten schwedischen Stahl... " gefertigt werden sollten, für die s.g. Spitz-Röhrchen und das
 Daumenblech gewöhnlicher Stahl genügen sollte. Der Schaft aus naturbelassenem Nussbaum-Holz, mit großer Wahrscheinlichkeit geölt und poliert, was die ziegelrote Färbung erklärt (die dunkle Beizung der Musketen mit Eisenschwärze kam erst unter König
Daumenblech gewöhnlicher Stahl genügen sollte. Der Schaft aus naturbelassenem Nussbaum-Holz, mit großer Wahrscheinlichkeit geölt und poliert, was die ziegelrote Färbung erklärt (die dunkle Beizung der Musketen mit Eisenschwärze kam erst unter König
 Friedrich II. auf). Auch mit großer Wahrscheinlichkeit kamen hier erstmals die per Reskript vom 16. Januar 1713 bestimmten
Friedrich II. auf). Auch mit großer Wahrscheinlichkeit kamen hier erstmals die per Reskript vom 16. Januar 1713 bestimmten  "Berliner Maße" zur Anwendung: Die nach dem metrischen System (siehe dazu "Berliner Maße" zur Anwendung: Die nach dem metrischen System (siehe dazu  WIKIPEDIA) gemessenen Längen eines Gewehrs in Gänze und seines Laufes als wichtigstes Bauteil weisen nach der Umrechnung in das damals gültige Zoll- bzw. Fuß-System in der Art erstaunlich "runde" Ergebnisse auf, dass ein Zufall nahezu ausgeschlossen werden kann, zumal dieses Gewehr-Modell Maßstab und Vorlage für eine Reihe von Folge-Modellen wurde, deren Maße wiederum von diesem Original abgeleitet werden können (wobei minimale Toleranzen einerseits produktions-, andererseits gebrauchs-bedingt zu sehen sind). WIKIPEDIA) gemessenen Längen eines Gewehrs in Gänze und seines Laufes als wichtigstes Bauteil weisen nach der Umrechnung in das damals gültige Zoll- bzw. Fuß-System in der Art erstaunlich "runde" Ergebnisse auf, dass ein Zufall nahezu ausgeschlossen werden kann, zumal dieses Gewehr-Modell Maßstab und Vorlage für eine Reihe von Folge-Modellen wurde, deren Maße wiederum von diesem Original abgeleitet werden können (wobei minimale Toleranzen einerseits produktions-, andererseits gebrauchs-bedingt zu sehen sind).
Die nach vorgegebenen Muster serienmäßig in den 1670 gegründeten "Henoul-Fabriken" gefertigten Musketen, die neben Preussen mit kleineren Änderungen wohl nach Kunden-Wunsch u.a. auch nach Frankreich und Spanien, in die Republik der Vereinigten Niederlande und bis hinauf nach Schweden verkauft wurden, waren für damalige Verhältnisse von durchgehend guter Qualität, in wichtigen Bauteilen weitestgehend kompatibel, was Ersatz und Reparatur erheblich vereinfachten, und im alltäglichen Dienst oder im Feld robust und pflegeleicht. Umstände, die König Friedrich Wilhelm I. dazu bewogen haben mochten, den
 Büchsenmacher am 25. April 1713 mit dem Titel "Grand armourier de Sa Majesté le Roy de Prusse" (Großer Waffenmeister Seiner Majestät des Königs von Preussen) auszuzeichnen.
Büchsenmacher am 25. April 1713 mit dem Titel "Grand armourier de Sa Majesté le Roy de Prusse" (Großer Waffenmeister Seiner Majestät des Königs von Preussen) auszuzeichnen.
Preussen bezog das vorgestellte Modell bis zum Jahr 1722 aus Lüttich. Ab dem Jahr 1723 (und so mit der Inbetrieb-Nahme der  "Königlichen Preussischen Gewehrfabrique" an den Standorten Potsdam und Spandau) begann dann die Fertigung des in beinahe allen Teilen und Maßen baugleichen "Königlichen Preussischen Gewehrfabrique" an den Standorten Potsdam und Spandau) begann dann die Fertigung des in beinahe allen Teilen und Maßen baugleichen  Infanterie-Gewehrs M/1723; dem ersten ausschließlich in Brandenburg-Preussen produzierten Armee-Gewehr. Infanterie-Gewehrs M/1723; dem ersten ausschließlich in Brandenburg-Preussen produzierten Armee-Gewehr.
Fraglich ist die in verschiedenen Quellen dargebrachte Auffassung, dass das Henoul-Gewehr in Anlehnung an
 französische Musketen gefertigt wurde: Denn selbst wenn man die ab 1690 in größeren Auflagen und verschiedenen Modell-Reihen für die überwiegend in Kanada operierenden "Compagnies franches de la Marine" (siehe dazu
französische Musketen gefertigt wurde: Denn selbst wenn man die ab 1690 in größeren Auflagen und verschiedenen Modell-Reihen für die überwiegend in Kanada operierenden "Compagnies franches de la Marine" (siehe dazu  WIKIPEDIA) bzw. deren Verbündete gefertigten Gewehre des s.g. WIKIPEDIA) bzw. deren Verbündete gefertigten Gewehre des s.g.
 "Fusil de Chasse Tulle" betrachtet, kann erst mit dem (serienmäßig in der 1675 gegründeten
"Fusil de Chasse Tulle" betrachtet, kann erst mit dem (serienmäßig in der 1675 gegründeten
 "Manufacture d'armes de Charleville" hergestellten) französischen
"Manufacture d'armes de Charleville" hergestellten) französischen
 Infanterie-Gewehr M/1717 von einer standardisierten Fertigung gesprochen werden. Darüber hinaus weisen beide Gewehre mit ihren typisch-geschwungenen Kolben objektiv wenig Ähnlichkeit mit der relativ geraden Schäftung der Lütticher Gewehre dieser Zeit auf.
Infanterie-Gewehr M/1717 von einer standardisierten Fertigung gesprochen werden. Darüber hinaus weisen beide Gewehre mit ihren typisch-geschwungenen Kolben objektiv wenig Ähnlichkeit mit der relativ geraden Schäftung der Lütticher Gewehre dieser Zeit auf.

Detail-Ansicht: Gravur des Büchsenmachers Francois Pholien Henoul auf dem Schloss eines zu Lüttich gefertigten Infanterie-Gewehrs vom Modell 1713
(Mit freundlichem Dank, Herrn J. Laschinger, Bayreuth)
~
|
| Hersteller-Angaben |
| Entwickler: |
"Fabrique Francois Pholien Henoul" |
| Fabrik (Gravur): |
'HENOUL' |
| Hersteller (Gravur): |
Francois Pholien Henoul 'HENOUL' |
| Produktionszeit: |
1713 bis 1722 |
| produzierte Stückzahl: |
keine Angaben |
| Verbreitung: |
Preussen u.a.
|
| Kategorisierung (allg.): |
siehe  Muskete Muskete
|
| Segmentierung |
| Gruppe: |
Vorder-Lader |
| Bereich: |
Nahbereichs-Waffe |
| Reichweite (effektiv): |
75 bis 150 m (max. 300 m) |
| Sektion: |
glattläufige, flintenartige (Gewehre) |
| Art: |
Muskete |
| System: |
Steinschloss-Zünder |
| Kadenz: |
2 bis 3 Schuss pro Minute |
| Typ: |
Infanterie-Gewehr |
| Modell: |
M/1713
|
Die folgenden Angaben sind Orientierungs-Werte, die je nach Einzel-Stück erheblich schwanken können (Angaben in Klammern benennen entweder Mittel-Werte verfügbarer Exponate oder beschreiben explizit das hier vorgestellte Beispiel). Die angeführten alten Maß-Angaben sind im Eintrag  Maße und Einheiten erklärt... Maße und Einheiten erklärt...
|
| technische Angaben |
| Gesamt-Länge: |
etwa 60,0 Berliner Zoll (156,0 cm) |
| Lauf-Länge: |
etwa 45,5 Berliner Zoll (117,5 cm) |
| Lauf-Befestigung: |
Stifte |
| Kaliber: |
(20,0 mm) |
| Kugel-Durchmesser: |
keine Angaben |
| Gewicht: |
ca. 5 kg |
| Schlossblech-Länge: |
etwa 180 mm |
| Schaft: |
Nussbaum-Vollschaft |
| Kimme: |
Nein |
| Korn (Messing): |
etwa 10 cm hinter der Lauf-Mündung |
| Modifikation: |
nicht bekannt
|
| Ansichts-Exemplar |
| Sammlung: |
 Armee-Museum Plassenburg; Kulmbach Armee-Museum Plassenburg; Kulmbach
|
|

Detail-Ansicht: Steinschloss des Modells 1713
|
... zu den  neupreussischen Feuer-Waffen (nach 1806 bis 1870) neupreussischen Feuer-Waffen (nach 1806 bis 1870)
... zurück zur  Übersicht preussische Feuer-Waffen Übersicht preussische Feuer-Waffen
... zurück zum  KOMPENDIUM der Waffenkunde - Verzeichnis KOMPENDIUM der Waffenkunde - Verzeichnis
|
|
|
|
Infanterie-Gewehr M 1723 (... auch Gewehr "lütticher Art" genannt) |
|

Infanterie-Gewehr Modell 1723; u.r.: s.g.
 "Daumenblech" mit den Initialen "FWR", dem Monogram des preussischen Königs
"Daumenblech" mit den Initialen "FWR", dem Monogram des preussischen Königs  Friedrich Wilhelm I., dass am Kolben-Hals von Gewehren oder Pistolen eingelassen war und i.d.R. bei Übernahme der Waffe vom nachfolgenden Regenten durch dessen Signum ersetzt wurde (Montage). Friedrich Wilhelm I., dass am Kolben-Hals von Gewehren oder Pistolen eingelassen war und i.d.R. bei Übernahme der Waffe vom nachfolgenden Regenten durch dessen Signum ersetzt wurde (Montage).
|
|
Vorläufer (Vorlage):
|
 Infanterie-Gewehr Modell 1713 Infanterie-Gewehr Modell 1713
|
Modifikation:
|
 Kavallerie-Karabiner Modell 1726 Kavallerie-Karabiner Modell 1726
|
|
|
Nachfolger:
|
 Infanterie-Gewehr Modell 1723/40 Infanterie-Gewehr Modell 1723/40
|
|
|
Die  Muskete vom Modell 1723 ist die preussische "Raub-Kopie" der s.g. Muskete vom Modell 1723 ist die preussische "Raub-Kopie" der s.g.  "Henoul-Flinte", der ersten seriell in Brandenburg gefertigten "Henoul-Flinte", der ersten seriell in Brandenburg gefertigten
 Feuer-Waffe für die preussische
Feuer-Waffe für die preussische
 Infanterie.
Infanterie.
Noch während seiner "Regentschaft" auf dem selbst geschaffenen Mustergut von Wusterhausen bei Berlin (siehe dazu  WIKIPEDIA) hatte der bald für seinen Geiz berühmte WIKIPEDIA) hatte der bald für seinen Geiz berühmte  Friedrich Wilhelm I. (1688 – 1740, besser bekannt als der "Soldatenkönig") zuschauen müssen, wie unzählige der vereinnahmten Steuer-Taler in Folge der kostspieligen und gleichsam zwingend notwendigen Aufrüstungen des preussischen Friedrich Wilhelm I. (1688 – 1740, besser bekannt als der "Soldatenkönig") zuschauen müssen, wie unzählige der vereinnahmten Steuer-Taler in Folge der kostspieligen und gleichsam zwingend notwendigen Aufrüstungen des preussischen
 Heeres außer Landes rollten. Und was auch immer den umtriebigen, für seine "direkte Art" gefürchteten Monarchen bewogen haben mag, den wallonischen
Heeres außer Landes rollten. Und was auch immer den umtriebigen, für seine "direkte Art" gefürchteten Monarchen bewogen haben mag, den wallonischen
 Büchsenmacher-Meister Francois Pholien Henoul am 25. April 1713 und somit genau zwei Monate nach seinem Regierungs-Antritt am 25. Februar 1713 mit dem Titel "Grand armourier de Sa Majesté le Roy de Prusse" (Großer Waffenmeister Seiner Majestät des Königs von Preussen) zu ehren – es muss der Beginn einer Freundschaft gewesen sein.
Büchsenmacher-Meister Francois Pholien Henoul am 25. April 1713 und somit genau zwei Monate nach seinem Regierungs-Antritt am 25. Februar 1713 mit dem Titel "Grand armourier de Sa Majesté le Roy de Prusse" (Großer Waffenmeister Seiner Majestät des Königs von Preussen) zu ehren – es muss der Beginn einer Freundschaft gewesen sein.
Henoul war der Besitzer einer von (seinem Vater?) Guillaume Henoul (auch Henouille) im Jahr 1670 gegründeten und inzwischen europaweit bekannten Gewehr-Fabrik mit Standorten in Namur und im Fürst-Bistum von Lüttich; mit Handels-Beziehungen von Spanien bis Russland, Schweden, Frankreich und Italien. Auch Preussen kaufte hier spätestens seit 1708 tausende
 Pistolen und
Pistolen und  Gewehre aller Art. Als dann um das Jahr 1717 die für ihren Geschäftssinn gerühmten Potsdamer Bankiers und als offizielle Lieferanten der Gewehre aller Art. Als dann um das Jahr 1717 die für ihren Geschäftssinn gerühmten Potsdamer Bankiers und als offizielle Lieferanten der
 preussische Armee bekannten Kaufmänner David Splittgerber und Gottfried Adolph Daum an ihren Regenten herantraten und ihm die Idee für eine
preussische Armee bekannten Kaufmänner David Splittgerber und Gottfried Adolph Daum an ihren Regenten herantraten und ihm die Idee für eine  "Königliche Preussische Gewehrfabrique" vorstellten, erkannte der stets wirtschaftlich kalkulierende König sofort die ihm hier entstehenden Vorteile: Nicht nur, dass er die für sein stetig wachsendes Heer dringend benötigten "Königliche Preussische Gewehrfabrique" vorstellten, erkannte der stets wirtschaftlich kalkulierende König sofort die ihm hier entstehenden Vorteile: Nicht nur, dass er die für sein stetig wachsendes Heer dringend benötigten
 Waffen im heimatlichen Preussen herstellen lassen konnte und damit dafür Sorge trug, dass das Geld im Lande blieb und sein kleines aber auf Expansion gerichtetes Reich nicht in die Abhängigkeit der Gunst seiner Nachbarn geriet, vielmehr bot sich ihm mit einer eigenen Manufaktur auch die Gelegenheit, einheitliche bzw. in einzelnen Teilen kompatible und damit kostengünstigere Waffen produzieren und diese bei Bedarf auch zeit- und ortsnah reparieren zu können. Vor allem aber lockten die Gewinne, die mit dem lukrativen Handel und Export von Waffen zu erzielen waren. Als Standorte wurden Spandau und Potsdam ausgemacht.
Waffen im heimatlichen Preussen herstellen lassen konnte und damit dafür Sorge trug, dass das Geld im Lande blieb und sein kleines aber auf Expansion gerichtetes Reich nicht in die Abhängigkeit der Gunst seiner Nachbarn geriet, vielmehr bot sich ihm mit einer eigenen Manufaktur auch die Gelegenheit, einheitliche bzw. in einzelnen Teilen kompatible und damit kostengünstigere Waffen produzieren und diese bei Bedarf auch zeit- und ortsnah reparieren zu können. Vor allem aber lockten die Gewinne, die mit dem lukrativen Handel und Export von Waffen zu erzielen waren. Als Standorte wurden Spandau und Potsdam ausgemacht.
Die nächsten Jahre vergingen mit dem Bau der Gebäude, der Beschaffung nötiger Werkzeuge und der Einrichtung der Werkstätten, in der auch  Blank-Waffen gefertigt werden sollten. Da für sämtliche Etappen der Sach-Verstand professioneller Büchsenmacher erforderlich war, lag es nahe, dieses Wissen dort "einzukaufen", wo die Anfertigung hochwertiger Waffen langjährige Tradition hatte: Infolge der annehmbar innigen Verhältnisse zwischen dem preussischen König und Meister Henoul konnte im Jahr 1721 Philipp Henoul, Sohn des Waffenmeisters, bewogen werden, ab 1721 in Danzig (heute Gdańsk; Polen) -, dann ab 1722 in Potsdam und Spandau die Planung, Einrichtung und schließlich auch in der Position eines Faktors (Werk-Meisters) die Leitung der Produktion der Rüstungs-Betriebe zu übernehmen. Unter seiner Führung arbeiteten allein am Standort Spandau ab 1722 einhunderteinundsiebzig in Lüttich geworbene Meister und Gesellen, die vom König neben einer katholischen Kirche samt zugehörigen Pfarrer und eigenen (eilends errichtete) Wohnhäusern samt Öfen und Obst-Gärten umfangreiche Privilegien erhielten. Blank-Waffen gefertigt werden sollten. Da für sämtliche Etappen der Sach-Verstand professioneller Büchsenmacher erforderlich war, lag es nahe, dieses Wissen dort "einzukaufen", wo die Anfertigung hochwertiger Waffen langjährige Tradition hatte: Infolge der annehmbar innigen Verhältnisse zwischen dem preussischen König und Meister Henoul konnte im Jahr 1721 Philipp Henoul, Sohn des Waffenmeisters, bewogen werden, ab 1721 in Danzig (heute Gdańsk; Polen) -, dann ab 1722 in Potsdam und Spandau die Planung, Einrichtung und schließlich auch in der Position eines Faktors (Werk-Meisters) die Leitung der Produktion der Rüstungs-Betriebe zu übernehmen. Unter seiner Führung arbeiteten allein am Standort Spandau ab 1722 einhunderteinundsiebzig in Lüttich geworbene Meister und Gesellen, die vom König neben einer katholischen Kirche samt zugehörigen Pfarrer und eigenen (eilends errichtete) Wohnhäusern samt Öfen und Obst-Gärten umfangreiche Privilegien erhielten.
Am 31. März 1722 unterzeichnete der König mit seinen Handels-Partnern Splittgerber und Daum einen Kooperations-Vertrag. Kaum ein Jahr später wurden die ersten Musketen des Modells 1723 für einen Stück-Preis von sechs Talern und neunzehn Groschen an die Truppe ausgeliefert; s.g. "Gewehre für Wach-Dienste", deren Schäfte aus Buche oder Ahorn gefertigt wurden, kosteten sechs Talern und sieben Groschen.
Bemerkenswert ist, dass die
 Maße der lütticher Modelle weitestgehend erhalten blieben, mit großer Wahrscheinlichkeit bis zum Jahr 1740 auch das "königlich-französische"
Maße der lütticher Modelle weitestgehend erhalten blieben, mit großer Wahrscheinlichkeit bis zum Jahr 1740 auch das "königlich-französische"
 Kaliber-Maß übernommen wurde, einzig das Schloss-Blech etwas kürzer zum Original gefertigt wurde und an Stelle der eisernen Beschläge von Kolben und Mündung sowie der Spitz-Röhrchen Teile aus Messing Verwendung fanden, die anfänglich drei-, dann acht-kantig geformt waren. Eine erste innovative Verbesserung war der ab 1718/19 stück-weise eingeführte und ab 1730 zum Standard gehörende eiserne
Kaliber-Maß übernommen wurde, einzig das Schloss-Blech etwas kürzer zum Original gefertigt wurde und an Stelle der eisernen Beschläge von Kolben und Mündung sowie der Spitz-Röhrchen Teile aus Messing Verwendung fanden, die anfänglich drei-, dann acht-kantig geformt waren. Eine erste innovative Verbesserung war der ab 1718/19 stück-weise eingeführte und ab 1730 zum Standard gehörende eiserne
 Ladestock, dessen Erfindung dem Fürsten Leopold I. von Anhalt-Dessau (der "Alte Dessauer", der als
Ladestock, dessen Erfindung dem Fürsten Leopold I. von Anhalt-Dessau (der "Alte Dessauer", der als
 General im preussischen Dienst stand; siehe dazu WIKIPEDIA) zugeschrieben wird, in den sächsischen Manufakturen (siehe dazu
General im preussischen Dienst stand; siehe dazu WIKIPEDIA) zugeschrieben wird, in den sächsischen Manufakturen (siehe dazu
 Suhler Innung) jedoch schon seit Beginn des 18. Jahrhunderts verbreitet war.
Suhler Innung) jedoch schon seit Beginn des 18. Jahrhunderts verbreitet war.
Zwischen 1724 bis 1731 produzierte die neu gegründete Gewehr-Fabrik jährlich rund sechstausend Infanterie-Gewehre. Auf der Basis des Infanterie-Modells wurde um 1726 noch eine kürzere und damit leichtere Version entwickelt und gefertigt, die als  Dragoner-Gewehr Modell 1726 eingeführt wurde ( Dragoner-Gewehr Modell 1726 eingeführt wurde (
 Dragoner zählten damals zur Infanterie). Im Jahr 1740 wurden die verausgabten Gewehre dann auf Order des Königs
Dragoner zählten damals zur Infanterie). Im Jahr 1740 wurden die verausgabten Gewehre dann auf Order des Königs
 Friedrich II. (1712 - 1786, besser bekannt als der "Große König") um etwa zehn bis elf Zentimeter gekürzt (siehe dazu
Friedrich II. (1712 - 1786, besser bekannt als der "Große König") um etwa zehn bis elf Zentimeter gekürzt (siehe dazu  Infanterie-Gewehr M/1723/40); die neuen Stücke (siehe dazu die s.g. Infanterie-Gewehr M/1723/40); die neuen Stücke (siehe dazu die s.g.  "Kuhfuß-Muskete" vom Modell 1740) von Beginn an kürzer gefertigt. "Kuhfuß-Muskete" vom Modell 1740) von Beginn an kürzer gefertigt.
~
|
| Hersteller-Angaben |
| Entwickler: |
"Fabrique Francois Pholien Henoul" |
| Fabrik (Gravur): |
Potsdam 'POTSDAMMAGAZ' |
| Hersteller (Gravuren): |
Splittgerber und Daum 'S&D' |
| Produktionszeit: |
1723 bis 1740 |
| produzierte Stückzahl: |
keine Angaben |
| Verbreitung: |
Preussen
|
| Kategorisierung (allg.): |
siehe  Muskete Muskete
|
| Segmentierung |
| Gruppe: |
Vorder-Lader |
| Bereich: |
Nahbereichs-Waffe |
| Reichweite (effektiv): |
75 bis 150 m (max. 300 m) |
| Sektion: |
glattläufige, flintenartige (Gewehre) |
| Art: |
Muskete |
| System: |
Steinschloss-Zünder |
| Kadenz: |
2 bis 3 Schuss pro Minute |
| Typ: |
Infanterie-Gewehr |
| Modell: |
M/1723
|
Die folgenden Angaben sind Orientierungs-Werte, die je nach Einzel-Stück erheblich schwanken können (Angaben in Klammern benennen entweder Mittel-Werte verfügbarer Exponate oder beschreiben explizit das hier vorgestellte Beispiel). Die angeführten alten Maß-Angaben sind im Eintrag  Maße und Einheiten erklärt... Maße und Einheiten erklärt...
|
| technische Angaben |
| Gesamt-Länge: |
etwa 60,0 Berliner Zoll (1.547,0 mm) |
| Lauf-Länge: |
etwa 44,5 Berliner Zoll (1.147,0 mm) |
| Lauf-Befestigung: |
Stifte |
| Kaliber: |
0,62 Pariser Zoll (16,8 mm) |
| Kugel-Durchmesser: |
0,60 Pariser Zoll (16,2 mm) |
| Gewicht: |
4 bis 6 kg (rund 4.800,0 g) |
| Schlossblech-Länge: |
178 mm |
| Schaft: |
Nussbaum-Vollschaft |
| Kimme: |
Nein |
| Korn (Messing): |
etwa 10 cm hinter der Lauf-Mündung |
| Modifikation: |
 Infanterie-Gewehr Modell 1723/40 Infanterie-Gewehr Modell 1723/40 |
| Adaptation (M 1723/40): |
Lauf um 36 Berl. Linien (ca. 113 mm) gekürzt
|
| Ansichts-Exemplar |
| Sammlung: |
 Wehrgeschichtliches Museum Rastatt Wehrgeschichtliches Museum Rastatt
|
|

Detail-Ansicht: Steinschloss des Modells 1723
|
... zu den  neupreussischen Feuer-Waffen (nach 1806 bis 1870) neupreussischen Feuer-Waffen (nach 1806 bis 1870)
... zurück zur  Übersicht preussische Feuer-Waffen Übersicht preussische Feuer-Waffen
... zurück zum  KOMPENDIUM der Waffenkunde - Verzeichnis KOMPENDIUM der Waffenkunde - Verzeichnis
|
|
|
Kavallerie-Karabiner M 1726 (... auch "Dragoner-Gewehr" genannt) |
|

Kavallerie-Gewehr Modell 1726, u.l.: s.g.
 "Daumenblech" mit den Initialen "FWR", dem Monogram des preussischen Königs
"Daumenblech" mit den Initialen "FWR", dem Monogram des preussischen Königs  Friedrich Wilhelm I., dass am Kolben-Hals von Gewehren oder Pistolen eingelassen war und i.d.R. bei Übernahme der Waffe vom nachfolgenden Regenten durch dessen Signum ersetzt wurde (Montage). Friedrich Wilhelm I., dass am Kolben-Hals von Gewehren oder Pistolen eingelassen war und i.d.R. bei Übernahme der Waffe vom nachfolgenden Regenten durch dessen Signum ersetzt wurde (Montage).
|
|
Vorläufer (Basis-Modell):
|
 Infanterie-Gewehr Modell 1723 Infanterie-Gewehr Modell 1723
|
Modifikation:
|
 Kavallerie-Karabiner Modell 1731 Kavallerie-Karabiner Modell 1731
|
|
|
Nachfolger:
|
 Kavallerie-Karabiner Modell 1787
Kavallerie-Karabiner Modell 1787
|
In den Jahren vor der Inbetrieb-Nahme der  "Königlichen Preussischeen Gewehrfabrique" bezog die preussische "Königlichen Preussischeen Gewehrfabrique" bezog die preussische
 Kavallerie beinahe sämtliche benötigten
Kavallerie beinahe sämtliche benötigten
 Karabiner und
Karabiner und
 Pistolen mit großer Wahrscheinlichkeit überwiegend aus den angestammten Werk-Stätten des lütticher
Pistolen mit großer Wahrscheinlichkeit überwiegend aus den angestammten Werk-Stätten des lütticher
 Büchsenmacher-Meisters Francois Pholien Henoul (wobei jedoch bislang keine originalen Stücke ausgemacht werden konnten).
Büchsenmacher-Meisters Francois Pholien Henoul (wobei jedoch bislang keine originalen Stücke ausgemacht werden konnten).
Auf Basis des  Infanterie-Gewehrs M 1723 begannen dann die königlichen Waffen-Fabriken in Spandau und Potsdam ab dem Jahr 1726 mit der Produktion einer kürzeren und damit leichteren Version für die Infanterie-Gewehrs M 1723 begannen dann die königlichen Waffen-Fabriken in Spandau und Potsdam ab dem Jahr 1726 mit der Produktion einer kürzeren und damit leichteren Version für die
 Dragoner, die zur berittenen
Dragoner, die zur berittenen
 Infanterie gezählt wurden (Dragoner sind halb Mensch, halb Vieh - zu Pferd gesetzte Infanterie). Neben der Möglichkeit, ein
Infanterie gezählt wurden (Dragoner sind halb Mensch, halb Vieh - zu Pferd gesetzte Infanterie). Neben der Möglichkeit, ein
 Bajonett aufpflanzen zu können, war das Dragoner-Gewehr eines der ersten Modelle, das zu Pferd nicht mehr am Riemen über der Schulter bzw. quer über dem Rücken sondern mittels einer "Stange" und eines Karabiner-Hakens am Bandelier (siehe dazu
Bajonett aufpflanzen zu können, war das Dragoner-Gewehr eines der ersten Modelle, das zu Pferd nicht mehr am Riemen über der Schulter bzw. quer über dem Rücken sondern mittels einer "Stange" und eines Karabiner-Hakens am Bandelier (siehe dazu
 Trageweise) getragen und zu Pferd bzw. am Bandelier eingehangen auch bedient werden konnte. Entgegen der französischen Trageweise führte die preussische Kavallerie (siehe dazu
Trageweise) getragen und zu Pferd bzw. am Bandelier eingehangen auch bedient werden konnte. Entgegen der französischen Trageweise führte die preussische Kavallerie (siehe dazu
 preussische Armee) Gewehre bzw. Karabiner am
preussische Armee) Gewehre bzw. Karabiner am
 Bandelier bis zur Einführung des
Bandelier bis zur Einführung des
 Karabiners Modell 1787 jedoch mit dem Kolben nach oben am Pferd. Die Mündung steckte dabei in einem kleinen Futteral, das mittels eines Riemens am Sattel befestigt war. Dieser Mündungs-Schuh sollte verhindern, dass der Ladestock während des Marsches verloren ging bzw. die Waffe bei einer schnelleren Gang-Art des Pferdes unkontrolliert herum schwang, was für Reiter und Pferd gefährlich werden konnte. Darüber hinaus musste das Schlossblech für die Handhabung zu Pferd flacher und kleiner werden, Kanten und Schwanenhals-Hahn wurden abgeschrägt, was im Ergebnis eine verkleinerte, aber dennoch neue und somit kosten-verursachende Schloss-Konstruktion zur Folge hatte. Da jedoch die einheitliche Bewaffnung der gesamten Kavallerie als großes Ziel stand, schien diese Investition gerechtfertigt. Der eiserne Ring um
Karabiners Modell 1787 jedoch mit dem Kolben nach oben am Pferd. Die Mündung steckte dabei in einem kleinen Futteral, das mittels eines Riemens am Sattel befestigt war. Dieser Mündungs-Schuh sollte verhindern, dass der Ladestock während des Marsches verloren ging bzw. die Waffe bei einer schnelleren Gang-Art des Pferdes unkontrolliert herum schwang, was für Reiter und Pferd gefährlich werden konnte. Darüber hinaus musste das Schlossblech für die Handhabung zu Pferd flacher und kleiner werden, Kanten und Schwanenhals-Hahn wurden abgeschrägt, was im Ergebnis eine verkleinerte, aber dennoch neue und somit kosten-verursachende Schloss-Konstruktion zur Folge hatte. Da jedoch die einheitliche Bewaffnung der gesamten Kavallerie als großes Ziel stand, schien diese Investition gerechtfertigt. Der eiserne Ring um
 Lauf und Schaft diente zur Halterung der Sattel-Stange, deren hinteres Ende mit einer Rundkopf-Schraube am schlangen-förmigen Schloss-Gegenblech fixiert war. Der hintere Riemen-Bügel bis 1763 am Kolben, dann am vorderen Abzugs-Bügel; der vordere Bügel vor dem zweiten Spitz-Röhrchen, der Steg im Schaft.
Lauf und Schaft diente zur Halterung der Sattel-Stange, deren hinteres Ende mit einer Rundkopf-Schraube am schlangen-förmigen Schloss-Gegenblech fixiert war. Der hintere Riemen-Bügel bis 1763 am Kolben, dann am vorderen Abzugs-Bügel; der vordere Bügel vor dem zweiten Spitz-Röhrchen, der Steg im Schaft.
König
 Friedrich II. (1712 - 1786, besser bekannt als der "Große König"), der von der schwerfälligen Kavallerie seines Vaters (siehe
Friedrich II. (1712 - 1786, besser bekannt als der "Große König"), der von der schwerfälligen Kavallerie seines Vaters (siehe  Friedrich Wilhelm I. (1688 – 1740, besser bekannt als der "Soldatenkönig") nur wenig überzeugt war, veranlasste nach seinem Regierungs-Antritt eine Reihe von Reformen. Und obwohl er seinen Friedrich Wilhelm I. (1688 – 1740, besser bekannt als der "Soldatenkönig") nur wenig überzeugt war, veranlasste nach seinem Regierungs-Antritt eine Reihe von Reformen. Und obwohl er seinen
 Kürassieren, Dragonern und
Kürassieren, Dragonern und
 Husaren die
Husaren die
 Feuer-Waffen beließ, bestimmte er per
Feuer-Waffen beließ, bestimmte er per
 A.K.O. vom 17. März 1742 in seinen Instruktionen für die Kavallerie: "Die Kommandeurs der Eskadrons sollen dafür responsable (verantwortlich) sein, dass kein Reiter oder Dragoner während der Bataille weder den Karabiner noch die Pistole gebraucht, sondern dass solche nur mit dem Degen in der Faust agieren."
A.K.O. vom 17. März 1742 in seinen Instruktionen für die Kavallerie: "Die Kommandeurs der Eskadrons sollen dafür responsable (verantwortlich) sein, dass kein Reiter oder Dragoner während der Bataille weder den Karabiner noch die Pistole gebraucht, sondern dass solche nur mit dem Degen in der Faust agieren."
Mit A.K.O. vom 3. April 1787 (bzw. 23. Oktober 1787; Einführung neuer Feuer-Waffen für Infanterie und Kavallerie) erging dann die Direktive, die Schäftung sämtlicher Gewehre und Karabinder umzuarbeiten (siehe dazu
 Preussen modernisiert). Kolben, Schaft und Lauf der verausgabten Dragoner-Gewehre wurden auf das Karabiner-Maß gekürzt und das Bajonett entfiel.
Preussen modernisiert). Kolben, Schaft und Lauf der verausgabten Dragoner-Gewehre wurden auf das Karabiner-Maß gekürzt und das Bajonett entfiel.

Auf Karabiner-Maß gekürztes Dragoner-Gewehr vom Modell 1726/87 (hier fehlend der eiserne Lauf-Ring samt der rück-seitigen Sattel-Stange; Bild-Quelle: ► Hermann Historica, München; Archiv 64. Auktion)
~
|
| Hersteller-Angaben |
| Entwickler: |
"Gewehrfabrique Potsdam" |
| Fabrik (Gravur): |
Potsdam 'POTSDAMMAGAZ' |
| Hersteller (Gravuren): |
Splittgerber und Daum 'S&D' |
| Produktionszeit: |
1726 bis 1787 |
| produzierte Stückzahl: |
keine Angaben |
| Verbreitung: |
Preussen, rheinische Provinzen, Sachsen
|
| Kategorisierung (allg.): |
siehe  Muskete Muskete
|
| Segmentierung |
| Gruppe: |
Vorder-Lader |
| Bereich: |
Nahbereichs-Waffe |
| Reichweite (effektiv): |
75 bis 150 m (max. 300 m) |
| Sektion: |
glattläufige, flintenartige (Gewehre) |
| Art: |
Muskete |
| System: |
Steinschloss-Zünder |
| Kadenz: |
2 bis 3 Schuss pro Minute |
| Typ: |
Kavallerie-Karabiner |
| Modell: |
M/1726
|
Die folgenden Angaben sind Orientierungs-Werte, die je nach Einzel-Stück erheblich schwanken können (Angaben in Klammern benennen entweder Mittel-Werte verfügbarer Exponate oder beschreiben explizit das hier vorgestellte Beispiel). Die angeführten alten Maß-Angaben sind im Eintrag  Maße und Einheiten erklärt... Maße und Einheiten erklärt...
|
| technische Angaben |
| Gesamt-Länge: |
55,0 Berliner Zoll (1.415,0 mm) |
| Lauf-Länge: |
40,0 Berliner Zoll (1.030,0 mm) |
| Lauf-Befestigung: |
Stifte und Ringe |
| Kaliber: |
0,62 Pariser Zoll (16,8 mm) |
| Kugel-Durchmesser: |
0,60 Pariser Zoll (16,2 mm) |
| Gewicht: |
4 bis 5 kg (4.040,0 g) |
| Schlossblech-Länge: |
155 mm |
| Schaft: |
Nussbaum-Vollschaft |
| Kimme: |
Nein |
| Korn (Messing): |
etwa 10 cm hinter der Lauf-Mündung |
| Modifikation: |
 Kavallerie-Karabiner Modell 1731 Kavallerie-Karabiner Modell 1731
|
| Ansichts-Exemplar |
| Sammlung: |
 Museum der polnischen Armee, Warschau Museum der polnischen Armee, Warschau
|
|

Detail-Ansicht: Steinschloss des Modells 1726 (hier ein Modell aus der Fertigung nach 1763 mit - fehlendem - Riemen-Bügel am vorderen Abzugs-Bügel)

|
... zu den  neupreussischen Feuer-Waffen (nach 1806 bis 1870) neupreussischen Feuer-Waffen (nach 1806 bis 1870)
... zurück zur  Übersicht preussische Feuer-Waffen Übersicht preussische Feuer-Waffen
... zurück zum  KOMPENDIUM der Waffenkunde - Verzeichnis KOMPENDIUM der Waffenkunde - Verzeichnis
|
|
|
Kavallerie-Karabiner M 1731 (... auch "Kürassier-Gewehr" genannt) |
|

Kavallerie-Karabiner Modell 1731, Montage (Bild-Quellen: ► kronoskaf - "The Seven Years War" und ► "The Vinkhuijzen collection of military uniforms"); o.l.: s.g.
 "Daumenblech" mit den Initialen "FWR", dem Monogram des preussischen Königs
"Daumenblech" mit den Initialen "FWR", dem Monogram des preussischen Königs  Friedrich Wilhelm I., dass am Kolben-Hals von Gewehren oder Pistolen eingelassen war und i.d.R. bei Übernahme der Waffe vom nachfolgenden Regenten durch dessen Signum ersetzt wurde. Friedrich Wilhelm I., dass am Kolben-Hals von Gewehren oder Pistolen eingelassen war und i.d.R. bei Übernahme der Waffe vom nachfolgenden Regenten durch dessen Signum ersetzt wurde.
|
|
Vorläufer (Basis-Modell):
|
 Kavallerie-Karabiner Modell 1726 Kavallerie-Karabiner Modell 1726
|
Nachfolger:
|
 Kavallerie-Karabiner Modell 1787
Kavallerie-Karabiner Modell 1787
|
In den Jahren vor der Inbetrieb-Nahme der  "Königliche Preussische Gewehrfabrique" bezog die preussische "Königliche Preussische Gewehrfabrique" bezog die preussische
 Kavallerie beinahe sämtliche benötigten
Kavallerie beinahe sämtliche benötigten
 Karabiner und
Karabiner und
 Pistolen mit großer Wahrscheinlichkeit überwiegend aus den angestammten Werk-Stätten des lütticher
Pistolen mit großer Wahrscheinlichkeit überwiegend aus den angestammten Werk-Stätten des lütticher
 Büchsenmacher-Meisters Francois Pholien Henoul (wobei jedoch bislang keine originalen Stücke ausgemacht werden konnten).
Büchsenmacher-Meisters Francois Pholien Henoul (wobei jedoch bislang keine originalen Stücke ausgemacht werden konnten).
Mit der Lieferung von rund 36.000  Infanterie-Gewehren des Modells 1723 im Jahr 1731 hatte die königlichen Waffen-Fabriken in Spandau und Potsdam ihren ersten Groß-Auftrag termin-gerecht erfüllt. Zwar war auf Basis dieses Infanterie-Gewehrs mit dem Infanterie-Gewehren des Modells 1723 im Jahr 1731 hatte die königlichen Waffen-Fabriken in Spandau und Potsdam ihren ersten Groß-Auftrag termin-gerecht erfüllt. Zwar war auf Basis dieses Infanterie-Gewehrs mit dem  Dragoner-Gewehr Modell 1726 parallel bereits eine kürzere und damit leichtere Version für die Kavallerie entwickelt und produziert worden, doch war dieses Gewehr für die Bedienung zu Pferd noch immer zu lang, zu schwer und zu unhandlich. Dragoner-Gewehr Modell 1726 parallel bereits eine kürzere und damit leichtere Version für die Kavallerie entwickelt und produziert worden, doch war dieses Gewehr für die Bedienung zu Pferd noch immer zu lang, zu schwer und zu unhandlich.
Mit dem Vertragswerk vom 17. September 1731 orderte König  Friedrich Wilhelm I. (1688 – 1740, besser bekannt als der "Soldatenkönig") insgesamt 7.920 Karabiner, mit denen die zwölf bestehenden, bzw. zwischen 1715 und 1718 reorganisierten bzw. neu formierten Friedrich Wilhelm I. (1688 – 1740, besser bekannt als der "Soldatenkönig") insgesamt 7.920 Karabiner, mit denen die zwölf bestehenden, bzw. zwischen 1715 und 1718 reorganisierten bzw. neu formierten
 Kürassier-Regimenter bis 1735 komplett neu bewaffnet werden sollten. Der rationell denkende König plante mit diesem Auftrag nicht nur das herrschende Durcheinander diverser Typen, Kaliber und Hersteller abschaffen zu können, sondern setzte auch darauf, die
Kürassier-Regimenter bis 1735 komplett neu bewaffnet werden sollten. Der rationell denkende König plante mit diesem Auftrag nicht nur das herrschende Durcheinander diverser Typen, Kaliber und Hersteller abschaffen zu können, sondern setzte auch darauf, die
 preussische Armee von kostspieligen Importen unabhängig zu machen.
preussische Armee von kostspieligen Importen unabhängig zu machen.
Der Effektivität halber sollte auch der neue Kavallerie-Karabiner in Anlehnung an die bisher für die
 Infanterie erstellten Gewehre gefertigt werden, doch waren einige kleinere Veränderungen nötig: Der Lauf des Karabiners erfuhr eine weitere Verkürzung um etwa 4 Berliner Zoll (ca. 103 mm) zum Dragoner-Gewehr, von dem jedoch das flache, kleinere Schlossblech mit abgeschrägten Kanten und Schwanenhals-Hahn übernommen wurde. Der eiserne Ring um
Infanterie erstellten Gewehre gefertigt werden, doch waren einige kleinere Veränderungen nötig: Der Lauf des Karabiners erfuhr eine weitere Verkürzung um etwa 4 Berliner Zoll (ca. 103 mm) zum Dragoner-Gewehr, von dem jedoch das flache, kleinere Schlossblech mit abgeschrägten Kanten und Schwanenhals-Hahn übernommen wurde. Der eiserne Ring um
 Lauf und Schaft diente (wie bereits beim
Lauf und Schaft diente (wie bereits beim
 Dragoner-Gewehr vom Modell 1726) zur Halterung der Sattel-Stange, deren hinteres Ende mit einer Rundkopf-Schraube am schlangen-förmigen Schloss-Gegenblech fixiert war. Der hintere Riemen-Bügel bis 1763 am Kolben, dann am vorderen Abzugs-Bügel; der vordere Bügel vor dem zweiten Spitz-Röhrchen, der Steg im Schaft.
Dragoner-Gewehr vom Modell 1726) zur Halterung der Sattel-Stange, deren hinteres Ende mit einer Rundkopf-Schraube am schlangen-förmigen Schloss-Gegenblech fixiert war. Der hintere Riemen-Bügel bis 1763 am Kolben, dann am vorderen Abzugs-Bügel; der vordere Bügel vor dem zweiten Spitz-Röhrchen, der Steg im Schaft.
König
 Friedrich II. (1712 - 1786, besser bekannt als der "Große König"), der von der schwerfälligen Kavallerie seines Vaters nur wenig überzeugt war, veranlasste nach seinem Regierungs-Antritt eine Reihe von Reformen. Und obwohl er seinen Kürassieren,
Friedrich II. (1712 - 1786, besser bekannt als der "Große König"), der von der schwerfälligen Kavallerie seines Vaters nur wenig überzeugt war, veranlasste nach seinem Regierungs-Antritt eine Reihe von Reformen. Und obwohl er seinen Kürassieren,
 Dragonern und
Dragonern und
 Husaren die
Husaren die
 Feuer-Waffen beließ, bestimmte er per
Feuer-Waffen beließ, bestimmte er per
 A.K.O. vom 17. März 1742 in seinen Instruktionen für die Kavallerie: "Die Kommandeurs der Eskadrons sollen dafür responsable (verantwortlich) sein, dass kein Reiter oder Dragoner während der Bataille weder den Karabiner noch die Pistole gebraucht, sondern dass solche nur mit dem Degen in der Faust agieren."
A.K.O. vom 17. März 1742 in seinen Instruktionen für die Kavallerie: "Die Kommandeurs der Eskadrons sollen dafür responsable (verantwortlich) sein, dass kein Reiter oder Dragoner während der Bataille weder den Karabiner noch die Pistole gebraucht, sondern dass solche nur mit dem Degen in der Faust agieren."
Die überarbeiteten Monogramme auf den wenigen noch erhaltenen Stücken bezeugen, dass die Karabiner noch lange nach 1786 und damit parallel zu den Modellen der
 Modell-Reihe 1787 getragen wurden.
Modell-Reihe 1787 getragen wurden.

~
|
| Hersteller-Angaben |
| Entwickler: |
"Gewehrfabrique Potsdam" |
| Fabrik (Gravur): |
Potsdam 'POTSDAMMAGAZ' |
| Hersteller (Gravuren): |
Splittgerber und Daum 'S&D' |
| Produktionszeit: |
1731 bis 1787 |
| produzierte Stückzahl: |
keine Angaben |
| Verbreitung: |
Preussen, rheinische Provinzen
|
| Kategorisierung (allg.): |
siehe  Muskete Muskete
|
| Segmentierung |
| Gruppe: |
Vorder-Lader |
| Bereich: |
Nahbereichs-Waffe |
| Reichweite (effektiv): |
75 bis 150 m (max. 300 m) |
| Sektion: |
glattläufige, flintenartige (Karabiner) |
| Art: |
Muskete |
| System: |
Steinschloss-Zünder |
| Kadenz: |
2 bis 3 Schuss pro Minute |
| Typ: |
Kavallerie-Karabiner |
| Modell: |
M/1731
|
Die folgenden Angaben sind Orientierungs-Werte, die je nach Einzel-Stück erheblich schwanken können (Angaben in Klammern benennen entweder Mittel-Werte verfügbarer Exponate oder beschreiben explizit das hier vorgestellte Beispiel). Die angeführten alten Maß-Angaben sind im Eintrag  Maße und Einheiten erklärt... Maße und Einheiten erklärt...
|
| technische Angaben |
| Gesamt-Länge: |
52,0 Berliner Zoll (1.290 - 1.340,0 mm) |
| Lauf-Länge: |
3 Berliner Fuß (930,0 – 948,0 mm) |
| Lauf-Befestigung: |
Stifte und Ringe |
| Kaliber: |
0,62 Pariser Zoll (16,8 mm) |
| Kugel-Durchmesser: |
0,60 Pariser Zoll (16,2 mm) |
| Gewicht: |
3 bis 4 kg (3.200 - 3.751 g) |
| Schlossblech-Länge: |
155 mm |
| Schaft: |
Nussbaum-Vollschaft |
| Kimme: |
in das Schwanzschrauben-Blatt eingefeilt |
| Korn (Messing): |
Ovalkorn etwa 10 cm hinter der Mündung |
| Modifikation: |
ab 1763 Riemen-Bügel am Abzugs-Bügel vorn
|
| Ansichts-Exemplar |
| Sammlung: |
 Deutsches Historisches Museum, Berlin Deutsches Historisches Museum, Berlin
|
|
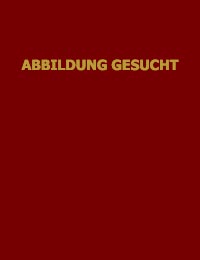
Komplett- und Detail-Ansichten gesucht...
Wir sind dankbar für jede Abbildung zum Thema. Ausgesprochen dankbar sind wir Ihnen, so Sie uns (soweit möglich bzw. bekannt) die Bild-Quelle und sämtliche relevanten Angaben (Ausstellungs-Ort, Maße, ggfs. Gewicht etc.) übermitteln könnten. Gern benennen wir Sie an dieser Stelle auch namentlich als Rechte-Inhaber bzw. Unterstützer dieses Projekts.
|
... zu den  neupreussischen Feuer-Waffen (nach 1806 bis 1870) neupreussischen Feuer-Waffen (nach 1806 bis 1870)
... zurück zur  Übersicht preussische Feuer-Waffen Übersicht preussische Feuer-Waffen
... zurück zum  KOMPENDIUM der Waffenkunde - Verzeichnis KOMPENDIUM der Waffenkunde - Verzeichnis
|
|
|
Infanterie-Gewehr M 1723/40 (... auch Flinte "kurzer Fasson" genannt) |
|

Infanterie-Gewehr Modell 1723/40; mittig: s.g.
 "Daumenblech" mit den Initialen "FR", dem Monogram des preussischen Königs
"Daumenblech" mit den Initialen "FR", dem Monogram des preussischen Königs
 Friedrich II. Die in der Regel aus Messing gefertigten Marken waren am Kolben-Hals von Gewehren oder Pistolen befestigt, kennzeichneten das jeweilige Stück als eine "Waffe des Königs" und wurden mit jedem Regierungswechsel ausgetauscht. Links:
Friedrich II. Die in der Regel aus Messing gefertigten Marken waren am Kolben-Hals von Gewehren oder Pistolen befestigt, kennzeichneten das jeweilige Stück als eine "Waffe des Königs" und wurden mit jedem Regierungswechsel ausgetauscht. Links:
 Bajonette der Modelle 1723 und 1740 (Montage).
Bajonette der Modelle 1723 und 1740 (Montage).
|
|
Vorläufer (Basis-Modell):
|
 Infanterie-Gewehr Modell 1723 Infanterie-Gewehr Modell 1723
|
Nachfolger:
|
 Infanterie-Gewehr Modell 1740 Infanterie-Gewehr Modell 1740
|
Die Annahme, dass mit längeren
 Läufen auch eine größere
Läufen auch eine größere
 Durchschlagskraft -, vor allem aber höhere
Durchschlagskraft -, vor allem aber höhere
 Reichweiten und bessere Treffer-Quoten erzielt werden könnten, war bereits mit der Erprobung und letztendlichen Einführung des
Reichweiten und bessere Treffer-Quoten erzielt werden könnten, war bereits mit der Erprobung und letztendlichen Einführung des  Dragoner-Gewehrs Modell 1726 widerlegt worden (das im Grunde nur eine kürzere und damit leichtere Version des Dragoner-Gewehrs Modell 1726 widerlegt worden (das im Grunde nur eine kürzere und damit leichtere Version des  Infanterie-Gewehrs vom Modell 1723 war). Darüber hinaus hatten praktische Vergleiche beider Infanterie-Gewehrs vom Modell 1723 war). Darüber hinaus hatten praktische Vergleiche beider  Waffen erwiesen, dass das Dragoner-Gewehr auf Grund des kürzeren Laufes messbar schneller geladen werden konnte. Waffen erwiesen, dass das Dragoner-Gewehr auf Grund des kürzeren Laufes messbar schneller geladen werden konnte.
Noch unter König  Friedrich Wilhelm I. (1688 – 1740, besser bekannt als der "Soldatenkönig") wurden die Friedrich Wilhelm I. (1688 – 1740, besser bekannt als der "Soldatenkönig") wurden die
 Dragoner der schnell beweglichen Infanterie zugerechnet. Kampf-Einsätze im Sattel waren nicht vorgesehen; die Pferde dienten ausschließlich dem Transport und somit der Mobilität. Diesen berittenen Infanteristen wurden als s.g.
Dragoner der schnell beweglichen Infanterie zugerechnet. Kampf-Einsätze im Sattel waren nicht vorgesehen; die Pferde dienten ausschließlich dem Transport und somit der Mobilität. Diesen berittenen Infanteristen wurden als s.g.
 "Eliten" bald die
"Eliten" bald die
 Grenadiere zu Pferd (1729) und die
Grenadiere zu Pferd (1729) und die
 Karabiniers (1738) zur Seite gestellt, die jedoch zunehmend mit
Karabiniers (1738) zur Seite gestellt, die jedoch zunehmend mit  Büchsen bewaffnet wurden. Büchsen bewaffnet wurden.
Um seinen
 Infanteristen nicht nur das Gewicht der auf Märschen zu tragenden
Infanteristen nicht nur das Gewicht der auf Märschen zu tragenden  Ausrüstung und Ausrüstung und
 Bewaffnung sondern insbesondere auch die Handhabung der von ihnen geführten
Bewaffnung sondern insbesondere auch die Handhabung der von ihnen geführten  Musketen im Feuer-Gefecht zu erleichtern, befahl König Musketen im Feuer-Gefecht zu erleichtern, befahl König
 Friedrich II. (1712 – 1786; später besser bekannt als "Der Große") nach seinem Regierungsantritt im Jahr 1740 und im Rahmen zahlreicher Militär-Reformen auch die Kürzung sämtlicher
Friedrich II. (1712 – 1786; später besser bekannt als "Der Große") nach seinem Regierungsantritt im Jahr 1740 und im Rahmen zahlreicher Militär-Reformen auch die Kürzung sämtlicher  Gewehre des Modells 1723 um etwa vier bis fünf Gewehre des Modells 1723 um etwa vier bis fünf  Berliner Zoll. Mit vierzig Zoll Lauf- und rund fünfundfünfzig Zoll Gesamt-Länge waren die Infanterie- und Dragoner-Gewehre damit weitestgehend gleichlang (wobei sich Toleranzen von etwa +/- 15mm nicht nur durch Schwankungen im Rahmen der Herstellung sondern auch in der offenbar schnell erfolgten Umarbeitung begründen dürften). Und so man bedenkt, dass die damalige Durchschnittsgröße eines erwachsenen Mannes bei etwa 166 cm lag, muss die Kürzung als praktische Maßnahme bewertet werden: Der preussische Berliner Zoll. Mit vierzig Zoll Lauf- und rund fünfundfünfzig Zoll Gesamt-Länge waren die Infanterie- und Dragoner-Gewehre damit weitestgehend gleichlang (wobei sich Toleranzen von etwa +/- 15mm nicht nur durch Schwankungen im Rahmen der Herstellung sondern auch in der offenbar schnell erfolgten Umarbeitung begründen dürften). Und so man bedenkt, dass die damalige Durchschnittsgröße eines erwachsenen Mannes bei etwa 166 cm lag, muss die Kürzung als praktische Maßnahme bewertet werden: Der preussische
 Musketier konnte nun beim
Musketier konnte nun beim
 Lade-Vorgang auf die Mündung seiner Waffe herabschauen und darüber hinaus den ab 1730 standartmäßig eingeführten eisernen
Lade-Vorgang auf die Mündung seiner Waffe herabschauen und darüber hinaus den ab 1730 standartmäßig eingeführten eisernen
 Ladestock wesentlich leichter händeln.
Ladestock wesentlich leichter händeln.
Kriterien, die im Ergebnis zur Steigerung der Feuer-Kadenz führten und dazu beitrugen, den legendären Ruf der preussischen
 Linien-Infanterie bezüglich ihrer außerordentlichen Feuer-Geschwindigkeit zu prägen. Letztendlich konnte infolge der Lauf-Kürzungen auch die reglementierte Mindest-Größe eines preussischen Infanteristen von sechsundsechzig auf dreiundsechzig - ab 1757 notgedrungen sogar auf sechzig - Zoll herabgesetzt werden.
Linien-Infanterie bezüglich ihrer außerordentlichen Feuer-Geschwindigkeit zu prägen. Letztendlich konnte infolge der Lauf-Kürzungen auch die reglementierte Mindest-Größe eines preussischen Infanteristen von sechsundsechzig auf dreiundsechzig - ab 1757 notgedrungen sogar auf sechzig - Zoll herabgesetzt werden.
Die kleiner gewachsenen
 Rekruten, die ab 1740 ausgehobenen und für die Infanterie ausgebildet wurden, dienten in den neu errichteten
Rekruten, die ab 1740 ausgehobenen und für die Infanterie ausgebildet wurden, dienten in den neu errichteten
 Füsilier-Regimentern, die in der
Füsilier-Regimentern, die in der  Schlacht-Ordnung das zweite Schlacht-Ordnung das zweite
 Treffen bildeten.
Treffen bildeten.
Ein besonderes Merkmal des Gewehr-Modells 1723/40 sind – neben dem alsbald ausgetauschten Daumenblech, dass das Gewehr nunmehr mit dem gekrönten Monogram FR für Fridericus Rex (lat. für "König Friedrich") als Waffe des Königs ausweist – die beinahe winkligen bzw. rauten-förmigen Schaft-Verschneidungen, die beinahe einer Einkerbung gleichen und vor allem die Haltung bzw. den Griff beim Anlegen und Zielen erleichtern sollten und in dieser Form bei allen Folge-Modellen in dieser Art nicht mehr vorkamen (bei den ab 1740 gefertigten Stücken geht der Schaft bogen-förmig in den nunmehr beinahe geraden Kolben über). Auch wurde die abgerundete Schloss-Platte des 23er Modells Stück für Stück durch ein gleichlanges aber nunmehr flaches Teil ausgetauscht, das für sämtliche ab 1740 produzierten Gewehre Standard wurde, sich jedoch trotzdem noch im geschwungenem oder spitz zulaufendem Ende unterschied. Eine weitere Neuerung war die Anweisung, dass Neu-Anfertigungen von nun an ein einheitliches
 Kaliber haben sollten (heute vorliegende Stücke weisen ein Mündungs-Kaliber von durchschnittlich 18,3 mm auf, was in etwa dem alten Berliner Maß von 0,70 Zoll -, bzw. dem heutigen Kaliber .72 entsprechen würde). Vorhandene Gewehre des 23er Modells sollten - soweit brauchbar und damit möglich - aufgebohrt werden.
Kaliber haben sollten (heute vorliegende Stücke weisen ein Mündungs-Kaliber von durchschnittlich 18,3 mm auf, was in etwa dem alten Berliner Maß von 0,70 Zoll -, bzw. dem heutigen Kaliber .72 entsprechen würde). Vorhandene Gewehre des 23er Modells sollten - soweit brauchbar und damit möglich - aufgebohrt werden.
~
|
| Hersteller-Angaben |
| Entwickler: |
"Gewehrfabrique Potsdam" |
| Fabrik (Gravur): |
Potsdam 'POTSDAMMAGAZ' |
| Hersteller (Gravuren): |
Splittgerber und Daum 'S&D' |
| Produktionszeit: |
1740/41 |
| produzierte Stückzahl: |
keine Angaben |
| Verbreitung: |
Preussen, Braunschweig, Mecklenburg
|
| Kategorisierung (allg.): |
siehe  Muskete Muskete
|
| Segmentierung |
| Gruppe: |
Vorder-Lader |
| Bereich: |
Nahbereichs-Waffe |
| Reichweite (effektiv): |
75 bis 150 m (max. 300 m) |
| Sektion: |
glattläufige, flintenartige (Gewehr) |
| Art: |
Muskete |
| System: |
Steinschloss-Zünder |
| Kadenz: |
3 bis 4 Schuss pro Minute |
| Typ: |
Infanterie-Gewehr |
| Modell: |
M/1723/40
|
Die folgenden Angaben sind Orientierungs-Werte, die im Vergleich mit anderen Stücken deutlich schwanken können (
 Hinweis öffnen).
Hinweis öffnen).
Abweichende Mess-Werte beim Vergleich historischer Original-Exemplare finden ihre Begründung bspw. in Toleranzen bei der Herstellung. Auch gab es erhebliche und anhaltende Unstimmigkeiten zwischen dem Berliner und dem im Jahr 1773 eingeführten rheinländischen Maß. Abweichungen bei Schaftungen, Läufen etc. begründen sich in der Regel mit der Abnutzung oder in Folge von Umarbeitung, Reparatur und Reinigung (siehe dazu auch
 Gewehr-Läufe
Gewehr-Läufe). Abweichende Angaben in Quellen finden ihre Ursache u.U. in Umrechnungs-Fehlern (häufig wurde hier das engliche Zoll zum "Maß aller Dinge" bestimmt, auch kann die Vielzahl der zu dieser Zeit gültigen deutschen Maße zu Fehlern führen).
Die angeführten alten Maß-Angaben sind im Eintrag  Maße und Einheiten erklärt. Maße und Einheiten erklärt.
|
| technische Angaben |
| Gesamt-Länge: |
ca. 55,5 Berliner Zoll (1.434,0 mm) |
| Lauf-Länge: |
ca. 40,0 Berliner Zoll (1.037,0 mm) |
| Lauf-Befestigung: |
Stifte |
| Kaliber: |
ca. 0,70 Berliner Zoll (18,3 mm) |
| Kugel-Durchmesser: |
ca. 0,68 Berliner Zoll (17,5 mm) |
| Gewicht: |
4.420 g |
| Schlossblech-Länge: |
178 mm |
| Schaft: |
Nussbaum-Vollschaft |
| Kimme: |
nein |
| Korn (Messing): |
Ovalkorn etwa 10 cm hinter der Mündung |
| Modifikation: |
keine
|
| Ansichts-Exemplar |
| Sammlung: |
Empfehlung gesucht
|
|

Detail-Ansicht: Steinschloss des Modells 1723/40 (hier ein Modell aus der Fertigung nach 1740 mit flachem Schloss-Blech)
|
... zu den  neupreussischen Feuer-Waffen (nach 1806 bis 1870) neupreussischen Feuer-Waffen (nach 1806 bis 1870)
... zurück zur  Übersicht preussische Feuer-Waffen Übersicht preussische Feuer-Waffen
... zurück zum  KOMPENDIUM der Waffenkunde - Verzeichnis KOMPENDIUM der Waffenkunde - Verzeichnis
|
|
|
Infanterie-Gewehr M 1740 (... auch "Kuhfuß-Muskete" genannt) |
|

Infanterie-Gewehr Modell 1740; oben: s.g.
 "Trophäen-Schilde" für
"Trophäen-Schilde" für
 Munitions-Taschen, daneben
Munitions-Taschen, daneben
 "Daumenblech" mit den Initialen "FR", dem Monogram des preussischen Königs
"Daumenblech" mit den Initialen "FR", dem Monogram des preussischen Königs
 Friedrich II., dass die Muskete zu einer "Waffe des Königs" erhob und bei einem Regierungswechsel durch das Stück des Nachfolgers ersetzt wurde; unten eine kürzere Version des
Friedrich II., dass die Muskete zu einer "Waffe des Königs" erhob und bei einem Regierungswechsel durch das Stück des Nachfolgers ersetzt wurde; unten eine kürzere Version des
 Bajonetts M/1740 (Montage).
Bajonetts M/1740 (Montage).
|
|
Vorläufer:
|
 Infanterie-Gewehr Modell 1723/40 Infanterie-Gewehr Modell 1723/40
|
Nachfolger:
|
 Infanterie-Gewehr Modell 1740/73
Infanterie-Gewehr Modell 1740/73
|
Schon kurz nach seinem Regierungs-Antritt (31. Mai 1740) verfügte
 Friedrich II. (1712 – 1786, besser bekannt als "Der Große König") eine ganze Reihe von Reformen, die neben der Justiz und der Religion, der Wirtschaft und der Verwaltung auch das Militär – insbesondere die
Friedrich II. (1712 – 1786, besser bekannt als "Der Große König") eine ganze Reihe von Reformen, die neben der Justiz und der Religion, der Wirtschaft und der Verwaltung auch das Militär – insbesondere die
 Taktik und die Verwendung der
Taktik und die Verwendung der  Waffen – betrafen. So sollte die Waffen – betrafen. So sollte die
 Kavallerie von nun an (und bald ausschließlich) mit
Kavallerie von nun an (und bald ausschließlich) mit
 Degen,
Degen,
 Säbel oder
Säbel oder
 Pallasch "agieren"; die
Pallasch "agieren"; die
 Infanterie exerzierte neben dem
Infanterie exerzierte neben dem
 Salven-Feuer vor allem den
Salven-Feuer vor allem den  Sturm-Angriff mit dem Sturm-Angriff mit dem
 Bajonett und das
Bajonett und das
 Bajonett-Fechten ("Bajonettieren"). Aus diesen u.a. Gründen waren die
Bajonett-Fechten ("Bajonettieren"). Aus diesen u.a. Gründen waren die
 Läufe der bereits verausgabten
Läufe der bereits verausgabten  Musketen vom Modell 1723 an Länge deutlich reduziert worden, was nicht nur den Vorteil hatte, dass die Waffen etwas leichter wurden, vielmehr konnte der durchschnittlich gewachsene preussische Musketen vom Modell 1723 an Länge deutlich reduziert worden, was nicht nur den Vorteil hatte, dass die Waffen etwas leichter wurden, vielmehr konnte der durchschnittlich gewachsene preussische
 Musketier beim
Musketier beim
 Lade-Vorgang auf die Mündung seiner Waffe herabschauen und den ab 1730 standartmäßig eingeführten eisernen
Lade-Vorgang auf die Mündung seiner Waffe herabschauen und den ab 1730 standartmäßig eingeführten eisernen
 Ladestock einfacher händeln; das
Ladestock einfacher händeln; das  Gewehr war schneller geladen, damit schneller feuer-bereit; womit letztendlich die Gewehr war schneller geladen, damit schneller feuer-bereit; womit letztendlich die
 Kadenz gesteigert werden konnte.
Kadenz gesteigert werden konnte.
Besonders auffällig an den ab Herbst 1740 neu ausgegebenen Infanterie-Gewehren war der klobige Kolben, der den Musketen den eigentümlichen Spitznamen "Kuhfuß" gab: Der relativ dünne Kolben-Hals des 23er-Modells, der für die Beanspruchungen beim Bajonettieren nicht robust genug schien bzw. sich im
 Nah-Kampf als Schwachpunkt erweisen könnte, wurde auf Befehl des Königs verstärkt. Auch war die abgewinkelte Neigung von Kolben-Hals und Kolben hin zur Schäftung für die Haltung des Gewehrs im Bajonett-Kampf bzw. für eine kraftvolle Stoß-Bewegung, wie etwa beim Ausfall-Stich oder dem s.g. Nach-Stoß (auch "Riposte"; siehe dazu
Nah-Kampf als Schwachpunkt erweisen könnte, wurde auf Befehl des Königs verstärkt. Auch war die abgewinkelte Neigung von Kolben-Hals und Kolben hin zur Schäftung für die Haltung des Gewehrs im Bajonett-Kampf bzw. für eine kraftvolle Stoß-Bewegung, wie etwa beim Ausfall-Stich oder dem s.g. Nach-Stoß (auch "Riposte"; siehe dazu  WIKIPEDIA) unpraktisch. Im Ergebnis bildeten bei den ab 1740 gefertigten Modellen Schaft und Kolben-Rücken in der gedachten Flucht eine durchgehende Linie, der Kolben-Hals wurde deutlich weniger abgewinkelt, dafür verstärkt, der Kolben selbst fiel plump und massiv und entsprechend gewichtig aus und war somit ganz offensichtlich auch für Schläge und/oder Stöße ausgelegt. Änderungen, die je nach Art des für die Schäftung verwendeten Holzes wieder eine Gewichts-Zunahme bedeuteten (etwa zweihundert Gramm bei Nussbaum; etwa fünfhundert Gramm für Buchen-Holz, das infolge des Mangels abgelagerter Nussbaum-Hölzer auf dem Höhepunkt des WIKIPEDIA) unpraktisch. Im Ergebnis bildeten bei den ab 1740 gefertigten Modellen Schaft und Kolben-Rücken in der gedachten Flucht eine durchgehende Linie, der Kolben-Hals wurde deutlich weniger abgewinkelt, dafür verstärkt, der Kolben selbst fiel plump und massiv und entsprechend gewichtig aus und war somit ganz offensichtlich auch für Schläge und/oder Stöße ausgelegt. Änderungen, die je nach Art des für die Schäftung verwendeten Holzes wieder eine Gewichts-Zunahme bedeuteten (etwa zweihundert Gramm bei Nussbaum; etwa fünfhundert Gramm für Buchen-Holz, das infolge des Mangels abgelagerter Nussbaum-Hölzer auf dem Höhepunkt des  Siebenjährigen Krieges als Ersatz Verwendung fand) und den Schwerpunkt des Gewehrs nach hinten verlagerten, was wieder Folgen für den Rückstoß im Moment des Abschusses hatte. Siebenjährigen Krieges als Ersatz Verwendung fand) und den Schwerpunkt des Gewehrs nach hinten verlagerten, was wieder Folgen für den Rückstoß im Moment des Abschusses hatte.
Obwohl der Kolben des 40er-Gewehrs die sehr einfach gestaltete Kolben-Backe des 23er-Modells weitestgehend übernommen hatte, erwies sich die beinahe geradlinig durchgehende Schäftung nun wieder beim Anlegen als hinderlich. Da beim Schießen jedoch das
 Peloton- oder Salven-Feuer bevorzugt wurde - der Infanterist mehr über den Lauf des vorgehaltenen Gewehrs peilte als tatsächlich zielte -, gab es keinen Anlass, die Stabilität der Waffen zu Gunsten des Zielens mit ungewisser Treffer-Quote abzuändern. Aus welchen Gründen aber die Läufe der neuen Gewehre im Vergleich zu den gekürzten Vorgänger-Modellen wieder um etwa ein halbes
Peloton- oder Salven-Feuer bevorzugt wurde - der Infanterist mehr über den Lauf des vorgehaltenen Gewehrs peilte als tatsächlich zielte -, gab es keinen Anlass, die Stabilität der Waffen zu Gunsten des Zielens mit ungewisser Treffer-Quote abzuändern. Aus welchen Gründen aber die Läufe der neuen Gewehre im Vergleich zu den gekürzten Vorgänger-Modellen wieder um etwa ein halbes  Berliner Zoll verlängert wurden, konnte bislang nicht geklärt werden. Dem entgegen beschreiben einzelne Quellen auch die Produktion einer um etwa einen Zoll kürzeren 40er-Musketen-Version für die ab 1723 bzw. ab 1740 errichteten Berliner Zoll verlängert wurden, konnte bislang nicht geklärt werden. Dem entgegen beschreiben einzelne Quellen auch die Produktion einer um etwa einen Zoll kürzeren 40er-Musketen-Version für die ab 1723 bzw. ab 1740 errichteten
 Füsilier-Regimenter, in die nunmehr die kleiner gewachsenen
Füsilier-Regimenter, in die nunmehr die kleiner gewachsenen
 Soldaten eingereiht wurden und die aus diesem Grund in der
Soldaten eingereiht wurden und die aus diesem Grund in der  Schlacht-Ordnung das zweite Schlacht-Ordnung das zweite
 Treffen bildeten. Der Rede nach soll der hintere Riemen-Bügel dieses Gewehrs bereits am Abzugs-Bügel befestigt worden sein, was mehr auf ein
Treffen bildeten. Der Rede nach soll der hintere Riemen-Bügel dieses Gewehrs bereits am Abzugs-Bügel befestigt worden sein, was mehr auf ein  Dragoner-Gewehr vom Modell 1726 aus der Fertigung nach 1763 schließen ließe. Die These, dass die kleineren Füsiliere ab 1740 grundsätzlich ein modifiziertes Dragoner-Gewehr geführt haben könnten, wäre auch dahingehend plausibel, so man die Länge des hier beschriebenen Modells – abzüglich eines Zolls – mit der durchschnittlichen Länge des Dragoner-Gewehrs M/1726 vergleicht: Beide Typen messen exakt fünfundfünfzig Zoll (was wiederum die These zulässt, dass es grundsätzlich nur ein leichteres bzw. kürzeres Modell gegeben haben könnte, das in zwei Versionen gefertigt wurde)... Dragoner-Gewehr vom Modell 1726 aus der Fertigung nach 1763 schließen ließe. Die These, dass die kleineren Füsiliere ab 1740 grundsätzlich ein modifiziertes Dragoner-Gewehr geführt haben könnten, wäre auch dahingehend plausibel, so man die Länge des hier beschriebenen Modells – abzüglich eines Zolls – mit der durchschnittlichen Länge des Dragoner-Gewehrs M/1726 vergleicht: Beide Typen messen exakt fünfundfünfzig Zoll (was wiederum die These zulässt, dass es grundsätzlich nur ein leichteres bzw. kürzeres Modell gegeben haben könnte, das in zwei Versionen gefertigt wurde)...
Strittig ist nach wie vor die Frage, wann das s.g. Schwärzen der Schäfte (das Auftragen einer Beize aus Eisenschwärze [ein Azetat, das aus der Reaktion von rostigen Eisen-Spänen in Essig-Säure entsteht]) aufkam: Constantin Kling nennt die Zeit nach dem Siebenjährigen Krieg, wobei es jedoch naheliegend wäre, dass bereits die aus hellem Buchen-Holz gefertigten Schäfte der Einheitlichkeit halber mit dem dunklen "Berliner Blau" (siehe dazu  WIKIPEDIA) gebeizt wurden, das dem Untergrund nach mehrfachen Auftragen eine tief-dunkelblaue bis blau-schwarze Tönung verleiht. WIKIPEDIA) gebeizt wurden, das dem Untergrund nach mehrfachen Auftragen eine tief-dunkelblaue bis blau-schwarze Tönung verleiht.
Fakt ist, dass das 40er Modell in Anlehnung an das Vorgänger-Modell produziert wurde, womit es aufgrund von Nach- oder Umarbeitungen auf den ersten Eindruck schnell zu Verwechslungen kommen kann. Erstes mögliches Identifizierungs-Merkmal eines Modells von 1741 ist die auf dem Schlossblech geänderte Gravur, die nach David Splitgerbers (1683 – 1764) Rückzug aus dem Waffen-Geschäft im Jahr 1741 die alleinige Führung der  "Königlich Preussischen Gewehrfabrique" durch Gottfried Adolph Daum (1679 – 1743) besiegelte und für "Splitgerbers Erben" stehen sollte ('DSE'; siehe dazu "Königlich Preussischen Gewehrfabrique" durch Gottfried Adolph Daum (1679 – 1743) besiegelte und für "Splitgerbers Erben" stehen sollte ('DSE'; siehe dazu  WIKIPEDIA). Das Blech selbst flach, wie es für sämtliche ab 1740 produzierten Teile Standard wurde, die sich jedoch noch in geschwungen oder spitz auslaufenden Enden unterschieden. Beide Versionen dieses Steinschlosses fanden auch in leicht kürzerer Version beim WIKIPEDIA). Das Blech selbst flach, wie es für sämtliche ab 1740 produzierten Teile Standard wurde, die sich jedoch noch in geschwungen oder spitz auslaufenden Enden unterschieden. Beide Versionen dieses Steinschlosses fanden auch in leicht kürzerer Version beim
 Husaren-Karabiner vom Modell 1742 Verwendung. Auch der Kolben wurde zwischen 1745 und 1780 in mehreren Schritten wieder reduziert und rückenseitig stärker abgewinkelt; letzte Fertigungen zeigen wieder eine wesentlich elegantere Form-Gebung. Ansonsten erfuhr das Modell von 1740 in den siebenundvierzig Jahren seiner Produktion eine ganze Reihe von kleineren Modifikationen. Genannt sein hier das Modell...
Husaren-Karabiner vom Modell 1742 Verwendung. Auch der Kolben wurde zwischen 1745 und 1780 in mehreren Schritten wieder reduziert und rückenseitig stärker abgewinkelt; letzte Fertigungen zeigen wieder eine wesentlich elegantere Form-Gebung. Ansonsten erfuhr das Modell von 1740 in den siebenundvierzig Jahren seiner Produktion eine ganze Reihe von kleineren Modifikationen. Genannt sein hier das Modell...
 M 1740/73 (größeres Kaliber, zylindrischer Ladestock)
M 1740/73 (größeres Kaliber, zylindrischer Ladestock) M 1740/80 (konisches Zündloch und Feuer-Schirm)
M 1740/80 (konisches Zündloch und Feuer-Schirm)
Über die im Rahmen des
 amerikanischen Unabhängigkeits-Krieges an die
amerikanischen Unabhängigkeits-Krieges an die
 britische Armee "vermieteten" hessischen Soldaten gelangte das hier beschriebene Modell auch nach Nord-Amerika.
britische Armee "vermieteten" hessischen Soldaten gelangte das hier beschriebene Modell auch nach Nord-Amerika.
~
|
| Hersteller-Angaben |
| Entwickler: |
"Gewehrfabrique Potsdam" |
| Fabrik (Gravur): |
Potsdam 'POTSDAMMAGAZ' |
| Hersteller (Gravuren): |
Daum &Splitgerbers Erben 'DSE' |
| Produktionszeit: |
1740 bis 1787 |
| produzierte Stückzahl: |
keine Angaben |
| Verbreitung: |
Preussen, Braunschweig, Hessen u.a.
|
| Kategorisierung (allg.): |
siehe  Muskete Muskete
|
| Segmentierung |
| Gruppe: |
Vorder-Lader |
| Bereich: |
Nahbereichs-Waffe |
| Reichweite (effektiv): |
75 bis 150 m (max. 300 m) |
| Sektion: |
glattläufige, flintenartige (Gewehre) |
| Art: |
Muskete |
| System: |
Steinschloss-Zünder |
| Kadenz: |
3 bis 4 Schuss pro Minute |
| Typ: |
Infanterie-Gewehr |
| Modell: |
M/1740
|
Die folgenden Angaben sind Orientierungs-Werte, die je nach Einzel-Stück erheblich schwanken können (Angaben in Klammern benennen entweder Mittel-Werte verfügbarer Exponate oder beschreiben explizit das hier vorgestellte Beispiel). Die angeführten alten Maß-Angaben sind im Eintrag  Maße und Einheiten erklärt... Maße und Einheiten erklärt...
|
| technische Angaben |
| Gesamt-Länge: |
ca. 56,0 Berliner Zoll; 1.440,0 – 1.455,0 mm |
| Lauf-Länge: |
ca. 40,5 Berliner Zoll; 1.045,0 – 1.047,0 mm |
| Lauf-Befestigung: |
Stifte |
| Kaliber: |
ca. 0,70 Berliner Zoll (18,3 mm) |
| Kugel-Durchmesser: |
ca. 0,68 Berliner Zoll (17,5 mm) |
| Gewicht: |
4.300 – 5.000 g (Buche 4.960 g) |
| Schlossblech-Länge: |
178 mm |
| Schaft: |
Nussbaum- oder Buche-Vollschaft |
| Kimme: |
nein |
| Korn (Messing): |
Ovalkorn etwa 10 cm hinter der Mündung |
| Modifikation: |
 Infanterie-Gewehr Modell 1740/73
Infanterie-Gewehr Modell 1740/73
 Infanterie-Gewehr Modell 1740/80
Infanterie-Gewehr Modell 1740/80
|
| Ansichts-Exemplar |
| Sammlung: |
 Deutsches Historisches Museum, Berlin Deutsches Historisches Museum, Berlin
|
|

Detail-Ansicht: Steinschloss des Modells 1740

Detail-Ansicht: Steinschloss des Modells 1740 mit Detail der Bestempelung "POTZDAMMAGAZIN", was die Potsdamer Manufaktur als Hersteller ausweist.
(Bild-Quelle: ► "Rock Island Auction Company" [Rock Island, Illinois, USA])
|
... zu den  neupreussischen Feuer-Waffen (nach 1806 bis 1870) neupreussischen Feuer-Waffen (nach 1806 bis 1870)
... zurück zur  Übersicht preussische Feuer-Waffen Übersicht preussische Feuer-Waffen
... zurück zum  KOMPENDIUM der Waffenkunde - Verzeichnis KOMPENDIUM der Waffenkunde - Verzeichnis
|
|
|