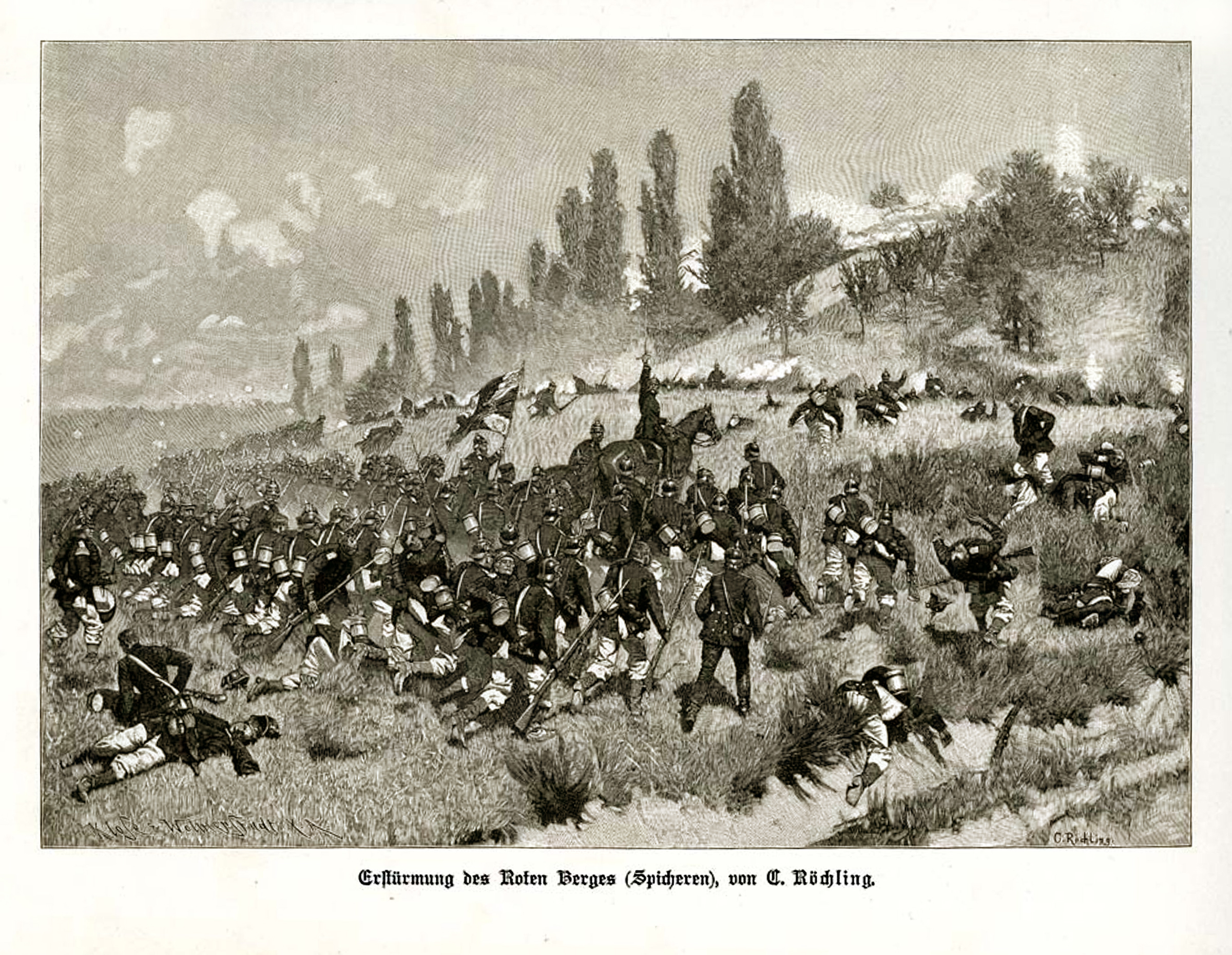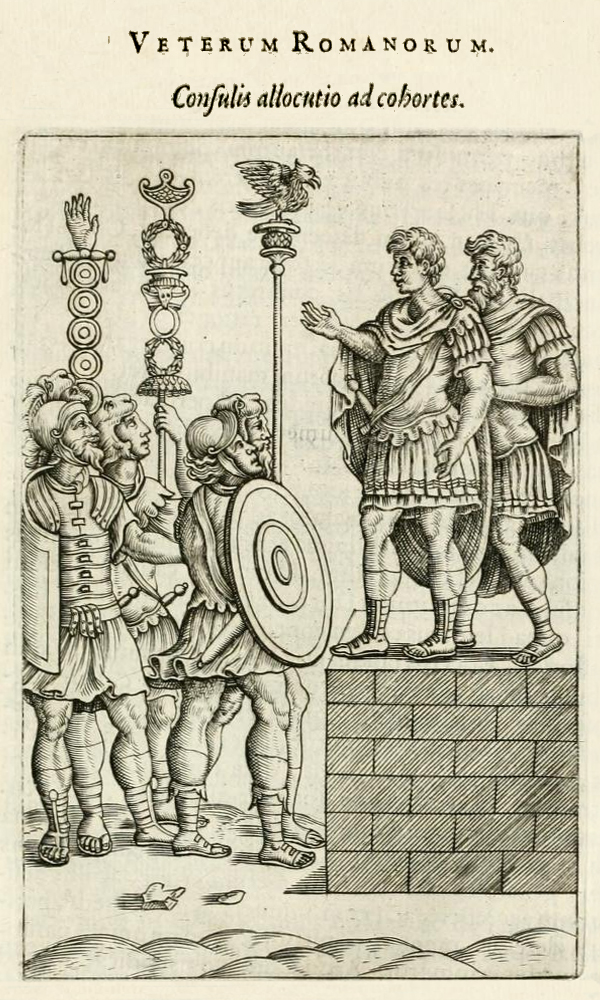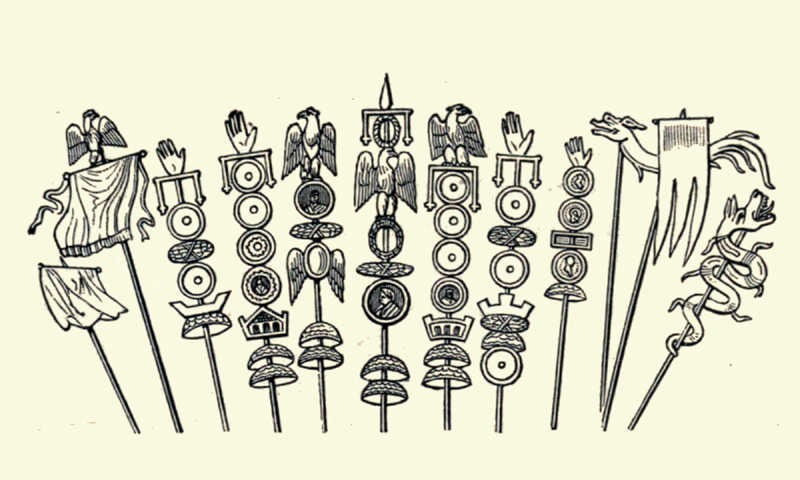Lexikon - Lexikon -
 äbel bis äbel bis
 ubaltern ubaltern
|
SAE Fahne eines kurfürstlich-sächsischen, königlich-polnischen Infanterie-Regiments nach 1697
(Quelle: ► Online-Sammlung des ► Schwedischen Armee-Museums, Stockholm) |
Sächsische Armee (Intro)
Die sächsische Armee war die
 Land-Streitkraft des Territorial- bzw. deutschen Klein-Staates Sachsen (siehe dazu
Land-Streitkraft des Territorial- bzw. deutschen Klein-Staates Sachsen (siehe dazu  WIKIPEDIA) in seinen jeweiligen Grenzen. Die WIKIPEDIA) in seinen jeweiligen Grenzen. Die  Armee bestand als kurfürstlich-sächsische bzw. königlich-sächsische Armee bestand als kurfürstlich-sächsische bzw. königlich-sächsische  Streitmacht in wechselnder Streitmacht in wechselnder
 Organisation,
Organisation,
 Struktur und
Struktur und
 Gliederung offiziell von 1612 bis 1918.
Gliederung offiziell von 1612 bis 1918.
... siehe dazu weiterführend  Die sächsische Armee (Einleitung) Die sächsische Armee (Einleitung)
... mehr zum Thema  Sachsen - Armee, Verbände und Einheiten Sachsen - Armee, Verbände und Einheiten
... siehe dazu ausführlich  WIKIPEDIA WIKIPEDIA
... zurück zum  Register Register
|
 Fahne III. Bataillon Königlich Sächsisches 1. (Leib) Grenadier-Regiment Nr. 100 um 1900
(Quelle: eigene Sammlung der Postkarten-Serie "Fahnen und Standarten"; Schild-Verlag München, 1980) |
SAE Wappen des Kurfürsten von Sachsen als König von Polen-Litauen (Montage) |
Sächsische Könige und Kurfürsten
Mit der Erhebung der "Askanier" (heute mehr oder weniger bekannt unter dem Titel "Haus Anhalt"; siehe dazu  WIKIPEDIA) in den Stand der Reichs- bzw. Kurfürsten durch König Karl IV. von Luxemburg (1316 - 1378; ab 1355 Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nationen; siehe dazu WIKIPEDIA) in den Stand der Reichs- bzw. Kurfürsten durch König Karl IV. von Luxemburg (1316 - 1378; ab 1355 Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nationen; siehe dazu  WIKIPEDIA), der baldigen Vereinnahmung oder Gewinnung, Übertragung oder Vererbung umliegender bzw. benachbarter Ländereien, begann im Jahre 1356 der Aufstieg des Herzogtums von Sachsen-Wittenberg zum Kurfürstentum von Sachsen. Der eigentliche Aufschwung Sachsens begann jedoch mit dem Beginn der Herrschaft der Wettiner (siehe dazu WIKIPEDIA), der baldigen Vereinnahmung oder Gewinnung, Übertragung oder Vererbung umliegender bzw. benachbarter Ländereien, begann im Jahre 1356 der Aufstieg des Herzogtums von Sachsen-Wittenberg zum Kurfürstentum von Sachsen. Der eigentliche Aufschwung Sachsens begann jedoch mit dem Beginn der Herrschaft der Wettiner (siehe dazu  WIKIPEDIA), die u.a. - temporär - die Mark Meißen, den Leipziger Kreis und die Grafschaft Thüringen in die Besitzung einbrachten. WIKIPEDIA), die u.a. - temporär - die Mark Meißen, den Leipziger Kreis und die Grafschaft Thüringen in die Besitzung einbrachten.
Militär-historisch interessant wird die Zeit ab der Regentschaft des Kurfürsten
 Johann Georg III. (1647 - 1691; genannt der "Sächsische Mars"), mit dem der Aufbau des sächsischen
Johann Georg III. (1647 - 1691; genannt der "Sächsische Mars"), mit dem der Aufbau des sächsischen
 "Stehenden Heeres" begann.
"Stehenden Heeres" begann.
Prunkvollste Epoche ist zweifellos die Zeit des Kurfürsten
 Friedrich August I. (1670 - 1733, besser bekannt als "August der Starke", ab 1697 als August II. König von Polen und Großherzog von Litauen).
Friedrich August I. (1670 - 1733, besser bekannt als "August der Starke", ab 1697 als August II. König von Polen und Großherzog von Litauen).
Kennzeichneten Aufstieg und Fall schon die Herrschaft von
 Friedrich August II. (1696 - 1763, seit 1733 Kurfürst von Sachsen und als August III. auch König von Polen und Großherzog von Litauen), so war die Erhebung zum Königreich unter
Friedrich August II. (1696 - 1763, seit 1733 Kurfürst von Sachsen und als August III. auch König von Polen und Großherzog von Litauen), so war die Erhebung zum Königreich unter
 Friedrich August III. (1750 - 1827, seit 1763 Kurfürst und ab 1806 als Friedrich August I. König von Sachsen) vielversprechend. Keine zehn Jahre später hatte Sachsen jedoch infolge der Beschlüsse des Wiener Kongresses (siehe dazu
Friedrich August III. (1750 - 1827, seit 1763 Kurfürst und ab 1806 als Friedrich August I. König von Sachsen) vielversprechend. Keine zehn Jahre später hatte Sachsen jedoch infolge der Beschlüsse des Wiener Kongresses (siehe dazu  WIKIPEDIA) knapp die Hälfte seines Territoriums, seiner Bevölkerung und damit seiner WIKIPEDIA) knapp die Hälfte seines Territoriums, seiner Bevölkerung und damit seiner  Armee verloren. Armee verloren.
Mit den legendären Abschiedsworten "Nu, denn machd doch eiern Drägg alleene" nahm
 Friedrich August III. (1865 - 1932, ab 1904 König von Sachsen) am 13. November 1918 seinen Abschied, legte Krone und Amt nieder, entband sämtliche Offiziere und Soldaten von ihrem Eid und zog sich nach Schlesien zurück. Mit ihm endete die Ära der Kurfürsten, Herzöge und Könige von Sachsen; das Bundesland wurde Freistaat.
Friedrich August III. (1865 - 1932, ab 1904 König von Sachsen) am 13. November 1918 seinen Abschied, legte Krone und Amt nieder, entband sämtliche Offiziere und Soldaten von ihrem Eid und zog sich nach Schlesien zurück. Mit ihm endete die Ära der Kurfürsten, Herzöge und Könige von Sachsen; das Bundesland wurde Freistaat.
... siehe dazu ausführlich  WIKIPEDIA WIKIPEDIA
... zurück zum  Register Register
|

Wappen des Königs von Sachsen bis 1918
(Quelle: ► WIKIPEDIA)
|
|
Christian II.
(* 23.09.1583 - † 23.06.1611) |
Johann Georg I.
(* 05.03.1585 - † 08.10.1656) |
Johann Georg II.
(* 20.06.1613 - † 22.08.1680) |
Johann Georg III.
(* 20.06.1647 - † 12.09.1691) |
Johann Georg IV.
(* 18.10.1668 - † 27.04.1694) |
Friedrich August I.
(August II. von Polen)
(* 12.05.1670 - † 01.02.1733) |
Friedrich August II.
(August III. von Polen)
(* 17.10.1696 - † 05.10.1763) |
Friedrich Christian I.
(* 05.09.1722 - † 17.12.1763) |
Friedrich August III.
(König Friedrich August I.)
(* 23.12.1750 - † 05.05.1827) |
Anton I.
(* 27.12.1755 - † 06.06.1836) |
Friedrich August II.
(* 18.05.1797 - † 09.08.1854) |
Johann I.
(* 12.12.1801 - † 29.10.1873) |
Albert I.
(* 23.04.1828 - † 19.06.1902) |
Georg I.
(* 08.08.1832 - † 15.10.1904) |
Friedrich August III.
(* 25.05.1865 - † 18.02.1932) |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Kurfürst ab 25.09.1591 |
Kurfürst ab 23.06.1611 |
Kurfürst ab 08.10.1656 |
Kurfürst ab 22.08.1680 |
Kurfürst ab 22.09.1691 |
Kurfürst ab 27.04.1694
König von Polen 15.09.1697 |
Kurfürst ab 01.02.1733
König von Polen 17.01.1734 |
Kurfürst ab 05.10.1763 |
Kurfürst ab 17.12.1763
König von Polen 03.05.1791
König von Sachsen 20.12.1806 |
König ab 05.05.1827 |
König ab 06.06.1836 |
König ab 09.08.1854 |
König ab 29.10.1873 |
König ab 19.06.1902 |
König ab 15.10.1904
Abdankung am 13.11.1918 |
|
|
SAG

"Sagittarius" um 50 v.u.Z.
Illustration aus "Caesar's Gallic War" von James Bradstreet Greenough u.a. (Ginn & Company; Boston 1899; online komplett verfügbar bei ► »archive.org«)
 "Sagittarius" um 50 u.Z.
Illustration aus "Illustrerad Verldshistoria" von Ernst Wallis, Chicago 1894
Online komplett verfügbar im Internet-Archiv ► »archive.org«.
|
Sagittarius
Als "Sagittarii" (von lat.: "Sagitta", der Pfeil; davon "Sagittarius", der Pfeil-Schütze; Plural: "Sagittarii") wurden in der
 römischen Legion die
römischen Legion die
 Bogen-Schützen bezeichnet.
Bogen-Schützen bezeichnet.
Ähnlich wie in den  antiken antiken
 griechischen Heeren wurde die
griechischen Heeren wurde die
 Waffen-Gattung der Bogen-Schützen anfänglich auch von den
Waffen-Gattung der Bogen-Schützen anfänglich auch von den
 Römern unterschätzt. Diese Einstellung änderte sich nach den ersten Bekanntschaften mit den kretischen Bogen-Schützen, die sich in den
Römern unterschätzt. Diese Einstellung änderte sich nach den ersten Bekanntschaften mit den kretischen Bogen-Schützen, die sich in den  Heeren diverser Mittelmeer-Staaten als Heeren diverser Mittelmeer-Staaten als
 Söldner verdingten, aber auch nach den Erfahrungen mit den skythischen Bogen-Schützen, die ihre Pfeile treffsicher vom Rücken ihrer Pferde verschossen.
Söldner verdingten, aber auch nach den Erfahrungen mit den skythischen Bogen-Schützen, die ihre Pfeile treffsicher vom Rücken ihrer Pferde verschossen.
Zusammen mit den  "Velites" (leichtbewaffneter Speer-Werfer) und den "Velites" (leichtbewaffneter Speer-Werfer) und den
 "Fundatores" (Schleuderer) wurden die Bogen-Schützen in der Zeit der römischen Republik den
"Fundatores" (Schleuderer) wurden die Bogen-Schützen in der Zeit der römischen Republik den
 "Rorarius" (Plänkler) zugeordnet. Dort hatten sie u.a. die Aufgabe, einen
"Rorarius" (Plänkler) zugeordnet. Dort hatten sie u.a. die Aufgabe, einen  Angreifer aus der Distanz bzw. aus der Angreifer aus der Distanz bzw. aus der
 Deckung einer
Deckung einer
 Befestigung abzuwehren oder den Aufmarsch des gegnerischen Heeres im
Befestigung abzuwehren oder den Aufmarsch des gegnerischen Heeres im
 Plänkler-Gefecht empfindlich zu stören, die Mannschaften der
Plänkler-Gefecht empfindlich zu stören, die Mannschaften der
 Ballisten zu decken oder die eigene
Ballisten zu decken oder die eigene
 Marsch-Formation abzusichern.
Marsch-Formation abzusichern.
Die
 Anwerbung von nicht-römischen Hilfs-Truppen, die sich durch individuelle bzw. regional-typische Kampf-Techniken auszeichneten, war bereits zur Zeit der römischen Republik üblich. Mit der Errichtung eines
Anwerbung von nicht-römischen Hilfs-Truppen, die sich durch individuelle bzw. regional-typische Kampf-Techniken auszeichneten, war bereits zur Zeit der römischen Republik üblich. Mit der Errichtung eines
 Stehenden Heeres unter
Stehenden Heeres unter
 Kaiser Augustus zu Beginn des 1. Jahrhunderts u.Z. wurden diese Kontingente dann in festen
Kaiser Augustus zu Beginn des 1. Jahrhunderts u.Z. wurden diese Kontingente dann in festen  Einheiten zusammengefasst, in Anlehnung an die Einheiten zusammengefasst, in Anlehnung an die
 Gliederung der regulären
Gliederung der regulären
 Kohorten weitestgehend einheitlich organisiert und als
Kohorten weitestgehend einheitlich organisiert und als  "Auxilia""Auxilia" der schweren "Auxilia""Auxilia" der schweren
 Infanterie einer Legion beigegeben. Bogen-Schützen zu Pferd, die in der Regel in einer
Infanterie einer Legion beigegeben. Bogen-Schützen zu Pferd, die in der Regel in einer  "Ala" dienten, wurden als "Ala" dienten, wurden als
 "Eques Sagittarii" oder auch "Arquites" bezeichnet und bspw. für
"Eques Sagittarii" oder auch "Arquites" bezeichnet und bspw. für
 Patrouillen entlang der Grenzen (siehe dazu
Patrouillen entlang der Grenzen (siehe dazu
 "Limes") oder innerhalb einer römischen
"Limes") oder innerhalb einer römischen
 Provinz eingesetzt aber auch mit der
Provinz eingesetzt aber auch mit der
 Aufklärung und der Verfolgung feindlicher Truppen beauftragt.
Aufklärung und der Verfolgung feindlicher Truppen beauftragt.
Die  Haupt-Waffe der "Sagittarii" waren Haupt-Waffe der "Sagittarii" waren
 Bogen ("Arcus" in "Patalus"- oder Sinus- bzw. Artemis-Form) samt einer unbestimmten Menge
Bogen ("Arcus" in "Patalus"- oder Sinus- bzw. Artemis-Form) samt einer unbestimmten Menge
 Pfeile ("Sagittae"; wobei hier bevorzugt Pfeile mit Widerhaken vom Typ "Sagitta hamata" Verwendung fanden). Dazu ein Köcher für den Bogen ("Corytus") und ein weiterer für die Pfeile ("Pharetra"), der entweder über dem Rücken, an der linken Seite oder über der rechten Schulter getragen wurde. Zur persönlichen
Pfeile ("Sagittae"; wobei hier bevorzugt Pfeile mit Widerhaken vom Typ "Sagitta hamata" Verwendung fanden). Dazu ein Köcher für den Bogen ("Corytus") und ein weiterer für die Pfeile ("Pharetra"), der entweder über dem Rücken, an der linken Seite oder über der rechten Schulter getragen wurde. Zur persönlichen
 Verteidigung das
Verteidigung das
 Kurz-Schwert ("Gladius hispanicum") und der kleine
Kurz-Schwert ("Gladius hispanicum") und der kleine
 Rund- oder Faust-Schild ("Clipeus").An dem Arm, der den Bogen führte, wurde ein sog. Bogner-Spannarmband ("Manica") angelegt, was jedoch das Tragen eines
Rund- oder Faust-Schild ("Clipeus").An dem Arm, der den Bogen führte, wurde ein sog. Bogner-Spannarmband ("Manica") angelegt, was jedoch das Tragen eines
 Schildes erschwerte. Zur weiteren
Schildes erschwerte. Zur weiteren  Schutz-Ausrüstung zählten der Helm ("Cassis") und der Leder-, Schuppen- oder Ketten-Panzer ("Lorica"; siehe dazu Schutz-Ausrüstung zählten der Helm ("Cassis") und der Leder-, Schuppen- oder Ketten-Panzer ("Lorica"; siehe dazu
 Rüstung).
Rüstung).
... mehr zum Thema:  KATEGORISIERUNG der Waffen KATEGORISIERUNG der Waffen
... siehe dazu ausführlich  WIKIPEDIA WIKIPEDIA
... zurück zum  Register Register
|
 Bogen-Typen (Montage);
von oben nach unten:
♦ skythischer Komposit-Bogen
♦ griechischer "Sinuosus" bzw. "Artemis"-Bogen
♦ griechisch-römischer "Arcus" oder "Cornus" in "Patalus"-Form
♦ Bogen-Köcher "Corytus"
(Illustration aus "Die Kriegswaffen in ihren geschichtlichen Entwickelungen von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart: eine Encyklopädie der Waffenkunde"; August Demmin, Verlag P. Friesenhahn, Leipzig 1893)
|
SAL |
Salpinx
Der Salpinx (griech.: Trompete) ist ein Blechblas-Instrument, das in den  Heeren der Heeren der
 griechischen
griechischen  Antike zur akustischen Antike zur akustischen
 Signal-Gebung verwendet wurde. Mit einer Länge von 80 bis 120 cm ist der Salpinx der römischen
Signal-Gebung verwendet wurde. Mit einer Länge von 80 bis 120 cm ist der Salpinx der römischen
 Tuba sehr ähnlich.
Tuba sehr ähnlich.
... siehe dazu ausführlich  WIKIPEDIA WIKIPEDIA
... zurück zum  Register Register
|
 Griechische Salpinx
(Illustration aus: "Meyers-Konversationslexikon"; 7. Auflage, 1929) |
SCH
 Ägyptisches Streitwagen-Korps (Pa-Djetu).
 Attische Phalanx.
 Makedonische Phalanx.
 Römische Manipular-Phalanx.
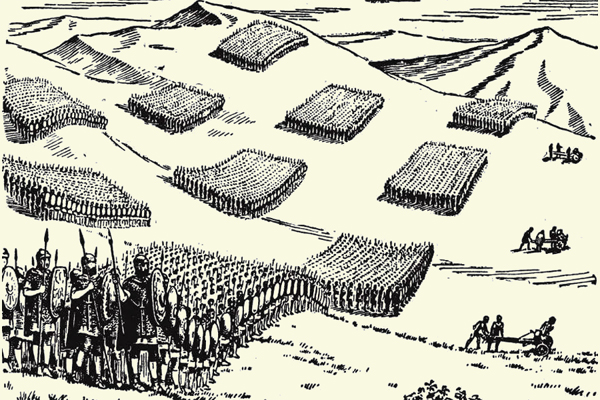 Römische Kohorten-Taktik.
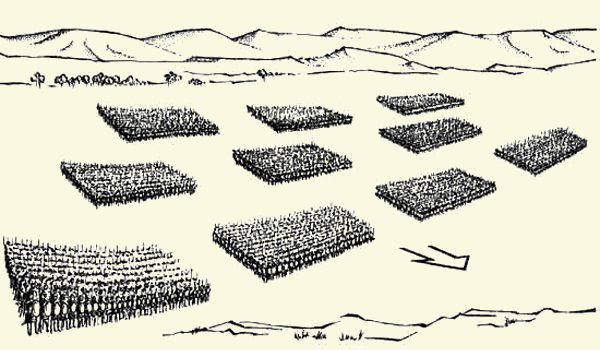 Römisches Kohorten-Treffen.
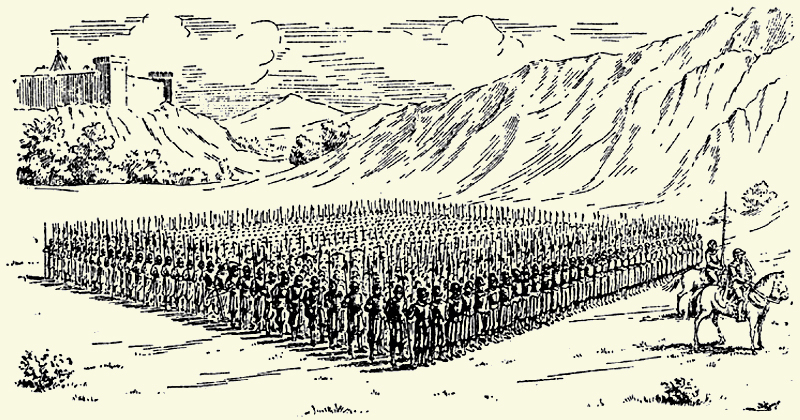 Eidgenössischer Gewalt-Haufen (Schweizer Geviert; 14. Jahrhundert).
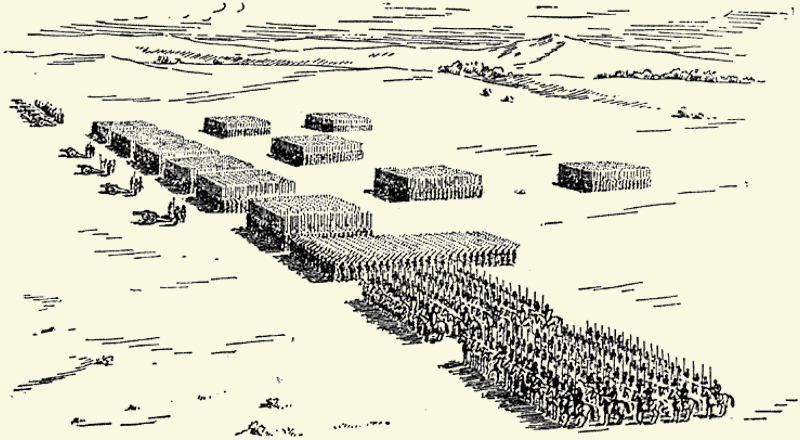 Brigade-Schlacht-Ordnung um 1500 (nach Niccolò Machiavelli).
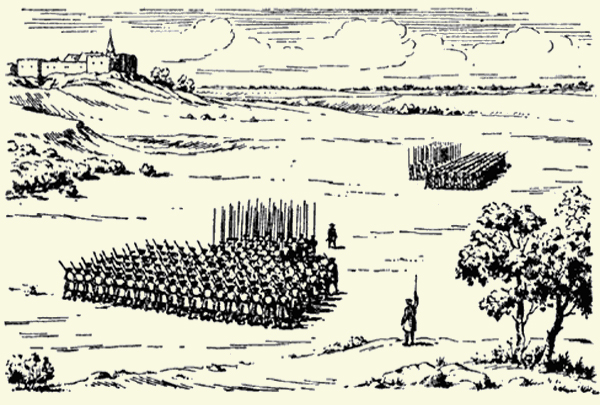 Aufmarsch einer Kompanie der schwedischen Armee zur Ordonnanz-Aufstellung (Schwedische Ordonnanz; Mitte 17. Jahrhundert).
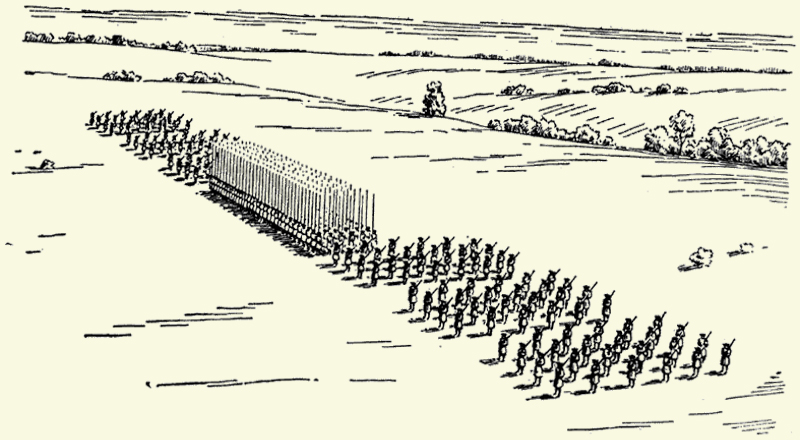 Schwedisches "Vier-Fähnlein" (Bataillon in Schwedischer Ordonnanz-Aufstellung).
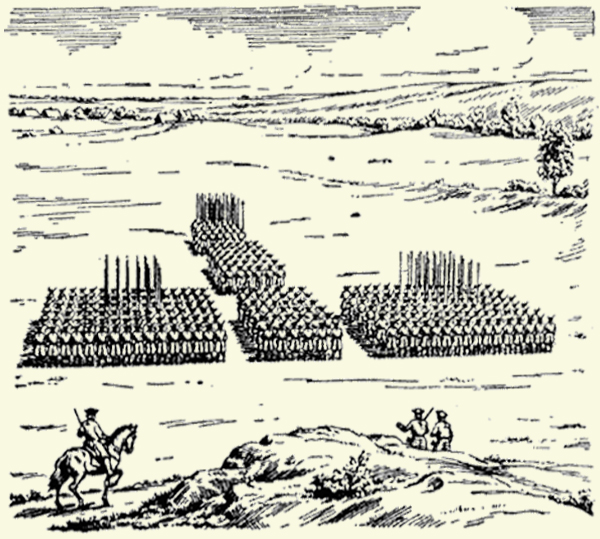 Schwedische Ordonnanz-Aufstellung eines Bataillons in der Schlacht bei Breitenfeld (23. Oktober 1642).
 Französische Musketiere in Pelote-Aufstellung (Ende 17. Jahrhundert).
(Russische Lehrbuch-Illustrationen).
|
Schlacht-Ordnung
(lat.: Acies, die Linie; engl.: Order of battle, Schlacht-Ordnung oder Battle formation, Schlacht-Formation; frz. Ordre de bataille, Schlacht-Aufstellung)
Die taktische  Aufstellung einer Aufstellung einer  Armee zu einer Armee zu einer
 Schlacht ist im Ideal-Fall die praktische Umsetzung eines in der Theorie erstellten
Schlacht ist im Ideal-Fall die praktische Umsetzung eines in der Theorie erstellten
 Schlacht-Plans (auch Schlacht-Strategie; siehe dazu
Schlacht-Plans (auch Schlacht-Strategie; siehe dazu
 Strategie und Taktik). In der Realität wird die Planung einer Schlacht-Ordnung hingegen nach wie vor durch diverse Umstände und Zufälle beeinflusst und ist somit von der Erfahrung und Vorbildung - in den meisten Fällen vom Improvisations-Talent - des
Strategie und Taktik). In der Realität wird die Planung einer Schlacht-Ordnung hingegen nach wie vor durch diverse Umstände und Zufälle beeinflusst und ist somit von der Erfahrung und Vorbildung - in den meisten Fällen vom Improvisations-Talent - des
 Feld-Herrn abhängig.
Feld-Herrn abhängig.
Schon die Strategen der  Antike dokumentierten ihre Erfahrungen zur Vorbereitung und Führung einer Schlacht und schufen so die theoretischen und didaktischen Voraussetzungen für eine sich entwickelnde akademische Antike dokumentierten ihre Erfahrungen zur Vorbereitung und Führung einer Schlacht und schufen so die theoretischen und didaktischen Voraussetzungen für eine sich entwickelnde akademische
 Kriegs-Schule.
Kriegs-Schule.
Bei der Aufstellung zu einer Schlacht-Ordnung waren und sind neben den Stärken der eigenen und gegnerischen Truppen samt jeweiligen
 Reserven, den aktuellen Positionen bzw. Bewegungen einzelner
Reserven, den aktuellen Positionen bzw. Bewegungen einzelner  Einheiten und Einheiten und  Verbände vor allem das Terrain bzw. die Topografie (die landschaftliche Gestaltung des ausgemachten Schlacht-Feldes), die hier gegebenen Boden-Verhältnisse samt den natürlichen Hindernissen, den Deckungs- und Rückzugs-Möglichkeiten, sowie das Vorhandensein von Pfaden, Wegen oder gar befestigten Straßen beachtenswert. Auch müssen Bewegungen der im Kampf-Gebiet operierenden Verbände vor allem das Terrain bzw. die Topografie (die landschaftliche Gestaltung des ausgemachten Schlacht-Feldes), die hier gegebenen Boden-Verhältnisse samt den natürlichen Hindernissen, den Deckungs- und Rückzugs-Möglichkeiten, sowie das Vorhandensein von Pfaden, Wegen oder gar befestigten Straßen beachtenswert. Auch müssen Bewegungen der im Kampf-Gebiet operierenden  Armee- oder para-militärischer
Frei-Korps des Gegners aufmerksam beobachtet werden. Armee- oder para-militärischer
Frei-Korps des Gegners aufmerksam beobachtet werden.
Schon in der Antike begann die Planung der optimalen
 Gliederung der eigenen Truppen im Raum bereits mit dem Aufmarsch der gegebenen
Gliederung der eigenen Truppen im Raum bereits mit dem Aufmarsch der gegebenen  Truppen- und Truppen- und
 Waffen-Gattungen: Zogen bspw. große Verbände der
Waffen-Gattungen: Zogen bspw. große Verbände der
 Kavallerie vor der
Kavallerie vor der
 Infanterie auf, konnte davon ausgegangen werden, dass ein geordneter Aufmarsch der Fuß-Truppen aufgrund des aufgewühlten Bodens behindert wenn nicht gar unmöglich wurde. Bezog die Infanterie hingegen ohne Bedeckung durch eigene Kavallerie-Verbände die vorgesehenen Positionen, wurde diese Gelegenheit mit hoher Wahrscheinlichkeit vom Gegner für eine überraschende
Infanterie auf, konnte davon ausgegangen werden, dass ein geordneter Aufmarsch der Fuß-Truppen aufgrund des aufgewühlten Bodens behindert wenn nicht gar unmöglich wurde. Bezog die Infanterie hingegen ohne Bedeckung durch eigene Kavallerie-Verbände die vorgesehenen Positionen, wurde diese Gelegenheit mit hoher Wahrscheinlichkeit vom Gegner für eine überraschende
 Attacke seiner Kavallerie genutzt. Noch zu Beginn des 21. Jahrhunderts hatten die Strategen konventioneller Armeen abzuwägen, in welchem Verhältnis leichte und schwere Truppen (leichte Aufklärungs- oder Schützen-Panzer etc. bzw. schwere Kampf-Panzer, Artillerie etc.) in das Kriegs-Gebiet vorstoßen; welche Aufgaben den eigenen Luft-Streitkräften in der Vorbereitung -, mit Beginn und im weiteren Verlauf einer Offensive zukommen; welche Schutz- und Abwehr-Maßnahmen im Fall gegnerischer Boden-Boden- oder Luft-Boden-Angriffe zu treffen sind und wie der erforderliche Nach-Schub organisiert und gesichert voran gebracht werden kann. Der zunehmende Einsatz von fern-gesteuerten Kampf-Drohnen und die rasante Entwicklung und Verwendung autonom operierender Kriegs-Roboter lassen jedoch darauf schließen, dass sich der Auf- und Ausbau von Verteidigungs-Linien in den Konflikten der Zukunft als ebenso sinnlos erweisen wird, wie das Heran-Führen von Panzer-Armeen, die etwa bis zur Jahrtausend-Wende zum Durchbrechen und Aufrollen tief gestaffelter Fronten-Systeme nötig waren. Hingegen wird die einfache Devise, "getrennt marschieren - vereint schlagen", die noch bis zum Ende des 20. Jahrhunderts grundsätzliche Voraussetzung für das Beziehen von Bereitstellungs-Räumen -, dem daran anschließenden Aufbau einer Schlacht-Ordnung und letztendlich dem Ausgang einer Schlacht war, im zunehmenden Maß auch für die "Robotic Combat Systems" des 21. Jahrhunderts Geltung haben wird.
Attacke seiner Kavallerie genutzt. Noch zu Beginn des 21. Jahrhunderts hatten die Strategen konventioneller Armeen abzuwägen, in welchem Verhältnis leichte und schwere Truppen (leichte Aufklärungs- oder Schützen-Panzer etc. bzw. schwere Kampf-Panzer, Artillerie etc.) in das Kriegs-Gebiet vorstoßen; welche Aufgaben den eigenen Luft-Streitkräften in der Vorbereitung -, mit Beginn und im weiteren Verlauf einer Offensive zukommen; welche Schutz- und Abwehr-Maßnahmen im Fall gegnerischer Boden-Boden- oder Luft-Boden-Angriffe zu treffen sind und wie der erforderliche Nach-Schub organisiert und gesichert voran gebracht werden kann. Der zunehmende Einsatz von fern-gesteuerten Kampf-Drohnen und die rasante Entwicklung und Verwendung autonom operierender Kriegs-Roboter lassen jedoch darauf schließen, dass sich der Auf- und Ausbau von Verteidigungs-Linien in den Konflikten der Zukunft als ebenso sinnlos erweisen wird, wie das Heran-Führen von Panzer-Armeen, die etwa bis zur Jahrtausend-Wende zum Durchbrechen und Aufrollen tief gestaffelter Fronten-Systeme nötig waren. Hingegen wird die einfache Devise, "getrennt marschieren - vereint schlagen", die noch bis zum Ende des 20. Jahrhunderts grundsätzliche Voraussetzung für das Beziehen von Bereitstellungs-Räumen -, dem daran anschließenden Aufbau einer Schlacht-Ordnung und letztendlich dem Ausgang einer Schlacht war, im zunehmenden Maß auch für die "Robotic Combat Systems" des 21. Jahrhunderts Geltung haben wird.
Nach wie vor kann eine konventionelle Schlacht noch vor dem eigentlichen Beginn bereits durch Unachtsamkeiten bei der Gliederung bzw. Reihenfolge der aufmarschierenden Truppen -, Fehler bei den zeitlichen Abläufen und Nachlässigkeiten bei der Sicherung aufmarschierender oder bereits positionierter Kontingente verloren gehen. Auch ist eine zahlenmäßig weitaus schwächere Partei durchaus in der Lage, einen weit überlegenen Gegner durch eine geschickt arrangierte Schlacht-Ordnung, dem Beziehen einer vorteilhaften Position oder der Anwendung einer überraschenden Taktik vernichtend zu schlagen. Und so im Rahmen der Planung einer Schlacht-Ordnung strategisch-taktische Ziele noch Berücksichtigung gefunden haben, ist nichts unberechenbarer als der tatsächliche Verlauf: Werden offensive oder defensive Optionen vernachlässigt, wird ein  Angriff auf eine gut formierte Defensiv-Aufstellung in der Regel nicht nur scheitern; vielmehr läuft der Angreifer im Fall eines Gegen-Angriffs selbst in die Gefahr, während seines Rückzugs im Abwehr-Feuer der eigenen Aufstellung erhebliche Verluste hinnehmen zu müssen. Werden Aufklärung und Sicherung vernachlässigt, kann ein Krieg trotz gewonnener Schlachten verloren gehen, wenn zwischen-zeitlich wichtige Depots, Magazine oder Rüstungs-Produktionsstätten in der Etappe bzw. im Hinter-Land vernichtet wurden. Angriff auf eine gut formierte Defensiv-Aufstellung in der Regel nicht nur scheitern; vielmehr läuft der Angreifer im Fall eines Gegen-Angriffs selbst in die Gefahr, während seines Rückzugs im Abwehr-Feuer der eigenen Aufstellung erhebliche Verluste hinnehmen zu müssen. Werden Aufklärung und Sicherung vernachlässigt, kann ein Krieg trotz gewonnener Schlachten verloren gehen, wenn zwischen-zeitlich wichtige Depots, Magazine oder Rüstungs-Produktionsstätten in der Etappe bzw. im Hinter-Land vernichtet wurden.
In der Regel war eine einmal gewählte Aufstellung auf den Schlacht-Feldern der Antike bis hin zu den Gefechts-Feldern zum Ende des 19. Jahrhunderts nur noch schwer und unter Hinnahme großer Risiken zu korrigieren. Für defensiv-taktische Operationen waren Aufstellungen erforderlich, die einerseits in der Front lang genug waren, um Umfassungen zu vermeiden, die andererseits aber auch in der Tiefe dicht genug gestaffelt waren, um nicht durchstoßen zu werden. Für offensiv-taktische Manöver war es erforderlich, in kürzester Zeit zahlen-mäßig überlegende Kräfte zusammenziehen -, konzentrieren und nach gezielter Vorbereitung durch die Artillerie energisch voranführen zu können, wobei es der gegnerischen Partei jedoch wiederum möglich war, gegen die ausgemachten Angriffs-Vorbereitungen geeignete Abwehr-Maßnehmen einzuleiten (so scheiterten viele Angriffe allein durch den Umstand, dass die zum Sturm oft dicht geballten Heeres-Abteilungen für die gegnerische Artillerie nicht zu verfehlende Ziele darstellten). Wichtigstes Kriterium der Aufstellung war jedoch die Deckung offensichtlicher Schwach-Stellen, wie bspw. die Sicherung offener
 Flanken, wobei natürliche Hindernisse wie Hügel, die mit Artillerie bewehrt wurden, aber auch Gewässer oder Sümpfe in Betracht kamen, künstliche Hindernisse wie
Flanken, wobei natürliche Hindernisse wie Hügel, die mit Artillerie bewehrt wurden, aber auch Gewässer oder Sümpfe in Betracht kamen, künstliche Hindernisse wie
 Feld-Befestigungen geschaffen oder vorhandene Ortschaften provisorisch befestigt und in das Defensiv-Konzept mit eingebunden wurden. In der Regel wurden jedoch schnell bewegliche Kavallerie-Verbände mit dem Schutz der gesamten Formation betraut, zwischen deren Flügel die schwere
Feld-Befestigungen geschaffen oder vorhandene Ortschaften provisorisch befestigt und in das Defensiv-Konzept mit eingebunden wurden. In der Regel wurden jedoch schnell bewegliche Kavallerie-Verbände mit dem Schutz der gesamten Formation betraut, zwischen deren Flügel die schwere
 Feld-Artillerie in Stellung ging, die bestenfalls nicht nur den Aufmarsch des Gegners zu stören oder dessen Angriff abzuwehren sondern auch den Vorstoß der eigenen Truppen vorzubereiten hatte.
Feld-Artillerie in Stellung ging, die bestenfalls nicht nur den Aufmarsch des Gegners zu stören oder dessen Angriff abzuwehren sondern auch den Vorstoß der eigenen Truppen vorzubereiten hatte.
Das Ende der rund 3.000 jährigen Geschichte der Schlacht-Ordnung wurde durch die Erfindung, Einführung und schnelle Verbreitung von
 maschinellen Feuer-Waffen eingeleitet, die gleichsam im Angriff als auch in der Verteidigung Verwendung fanden und für die Massen-Heere des endenden 19. Jahrhunderts sprich-wörtlich "verheerende" Konsequenzen hatten. Dementsprechend galt es also nicht nur Reserven bereitzuhalten, die schnell an plötzlich entstehende Brennpunkte herangeführt werden und dort eingreifen konnten, sondern auch Räume zu erkennen, die für die sichere Entfaltung des eigenen
maschinellen Feuer-Waffen eingeleitet, die gleichsam im Angriff als auch in der Verteidigung Verwendung fanden und für die Massen-Heere des endenden 19. Jahrhunderts sprich-wörtlich "verheerende" Konsequenzen hatten. Dementsprechend galt es also nicht nur Reserven bereitzuhalten, die schnell an plötzlich entstehende Brennpunkte herangeführt werden und dort eingreifen konnten, sondern auch Räume zu erkennen, die für die sichere Entfaltung des eigenen
 Heeres geeignete Voraussetzungen boten.
Heeres geeignete Voraussetzungen boten.
Der
 Graben-Krieg begann.
Graben-Krieg begann.
Als erste klassische Schlacht-Ordnung gilt die griechische
 Phalanx, aus der sich die
Phalanx, aus der sich die
 Treffen-Formation der
Treffen-Formation der
 römischen Legion entwickelte. Diese Formation war wiederum Vorbild für die
römischen Legion entwickelte. Diese Formation war wiederum Vorbild für die  mittelalterlichen mittelalterlichen
 Gewalt- oder Geviert-Haufen, die bis zum
Gewalt- oder Geviert-Haufen, die bis zum  Dreißigjährigen Krieg Standard-Aufstellung der europäischen Heere blieb. Dreißigjährigen Krieg Standard-Aufstellung der europäischen Heere blieb.
Mit der zunehmenden Verbreitung schwerer und leichter
 Feuer-Waffen, insbesondere der
Feuer-Waffen, insbesondere der
 flinten-artigen
flinten-artigen
 Hand-Feuer-Waffen, die im Grunde einzig in der ersten und zweiten Reihe einer Aufstellung eingesetzt werden und hier aus Gründen diverser technischer Entwicklungs- und qualitativer Fertigungs-Mängel nur im Salven-Feuer effektiv zu Wirkung kommen konnten, bildete sich die
Hand-Feuer-Waffen, die im Grunde einzig in der ersten und zweiten Reihe einer Aufstellung eingesetzt werden und hier aus Gründen diverser technischer Entwicklungs- und qualitativer Fertigungs-Mängel nur im Salven-Feuer effektiv zu Wirkung kommen konnten, bildete sich die
 Linear-Taktik heraus, an die sich direkt die
Linear-Taktik heraus, an die sich direkt die
 Kolonnen-Taktik der napoleonischen Epoche anschloss. Und erstreckten sich die Fronten antiker Schlacht-Ordnungen noch über einige hundert Meter, beanspruchten die in zwei oder mehr
Kolonnen-Taktik der napoleonischen Epoche anschloss. Und erstreckten sich die Fronten antiker Schlacht-Ordnungen noch über einige hundert Meter, beanspruchten die in zwei oder mehr
 Treffen aufmarschierenden Söldner-Heere zur Mitte des 17. Jahrhunderts bereits Meilen. Die Linear- und Kolonnen-Schlacht-Ordnungen der Moderne erreichten schließlich Längen, die neben dem Feld-Herren als Ober-Kommandierenden mehrere Abschnitts-Kommandeure erforderlich machten, die in der Regel Flügel- und Flanken-Verbände befehligten, die selbst wieder eigene Ordnungen aufwiesen. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts umfassten Schlacht-Felder bereits mehrere Hundert Hektar; die Schlacht-Felder der Welt-Kriege erstreckten sich schließlich über Länder-Grenzen.
Treffen aufmarschierenden Söldner-Heere zur Mitte des 17. Jahrhunderts bereits Meilen. Die Linear- und Kolonnen-Schlacht-Ordnungen der Moderne erreichten schließlich Längen, die neben dem Feld-Herren als Ober-Kommandierenden mehrere Abschnitts-Kommandeure erforderlich machten, die in der Regel Flügel- und Flanken-Verbände befehligten, die selbst wieder eigene Ordnungen aufwiesen. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts umfassten Schlacht-Felder bereits mehrere Hundert Hektar; die Schlacht-Felder der Welt-Kriege erstreckten sich schließlich über Länder-Grenzen.
Den Schlacht-Ordnungen der vergangenen Jahrhunderte ist gemein, dass die Infanterie das Zentrum der Aufstellung bildete. Den Schutz der Flanken bzw. die Naht-Stellen zu benachbarten  Divisionen, Korps oder darüber hinaus gehende Groß-Verbände übernahmen schnell bewegliche Truppen- bzw. deren Waffen-Gattungen. Zwischen und hinter den einzelnen Kontingenten deckten Artillerie-Einheiten die gesamte Formation. Mit dem Übergang vom Bewegungs-Krieg zum Stellungs-Krieg im russisch-japanischen Krieg zwischen 1904 bis 1905 (siehe dazu ausführlich Divisionen, Korps oder darüber hinaus gehende Groß-Verbände übernahmen schnell bewegliche Truppen- bzw. deren Waffen-Gattungen. Zwischen und hinter den einzelnen Kontingenten deckten Artillerie-Einheiten die gesamte Formation. Mit dem Übergang vom Bewegungs-Krieg zum Stellungs-Krieg im russisch-japanischen Krieg zwischen 1904 bis 1905 (siehe dazu ausführlich  WIKIPEDIA) und dem Scheitern der deutschen "Blitzkrieg-Strategie" im I. Weltkrieg (siehe dazu ausführlich WIKIPEDIA) und dem Scheitern der deutschen "Blitzkrieg-Strategie" im I. Weltkrieg (siehe dazu ausführlich  WIKIPEDIA) verloren Schlacht-Ordnungen mehr und mehr an Bedeutung; ineinander übergehende bzw. aneinander anschließende WIKIPEDIA) verloren Schlacht-Ordnungen mehr und mehr an Bedeutung; ineinander übergehende bzw. aneinander anschließende
 Fronten bildeten zu Beginn des I. Weltkrieges immer komplexer ausgebaute Hauptkampf-Linien der einander gegenüberstehenden Streit-Kräfte.
Fronten bildeten zu Beginn des I. Weltkrieges immer komplexer ausgebaute Hauptkampf-Linien der einander gegenüberstehenden Streit-Kräfte.
Zu den klassischen Schlacht-Ordnungen zählen:
Die Aufstellung moderner Armeen vor bzw. innerhalb einer Schlacht wird überwiegend als
 Gefechts-Ordnung bezeichnet, die aus einzelnen
Gefechts-Ordnung bezeichnet, die aus einzelnen
 Gefechts-Formationen gebildet wird.
Gefechts-Formationen gebildet wird.
... mehr zum Thema:  Schlacht-Ordnungen der Zeit Napoleons Schlacht-Ordnungen der Zeit Napoleons
... zurück zum  Register Register
|
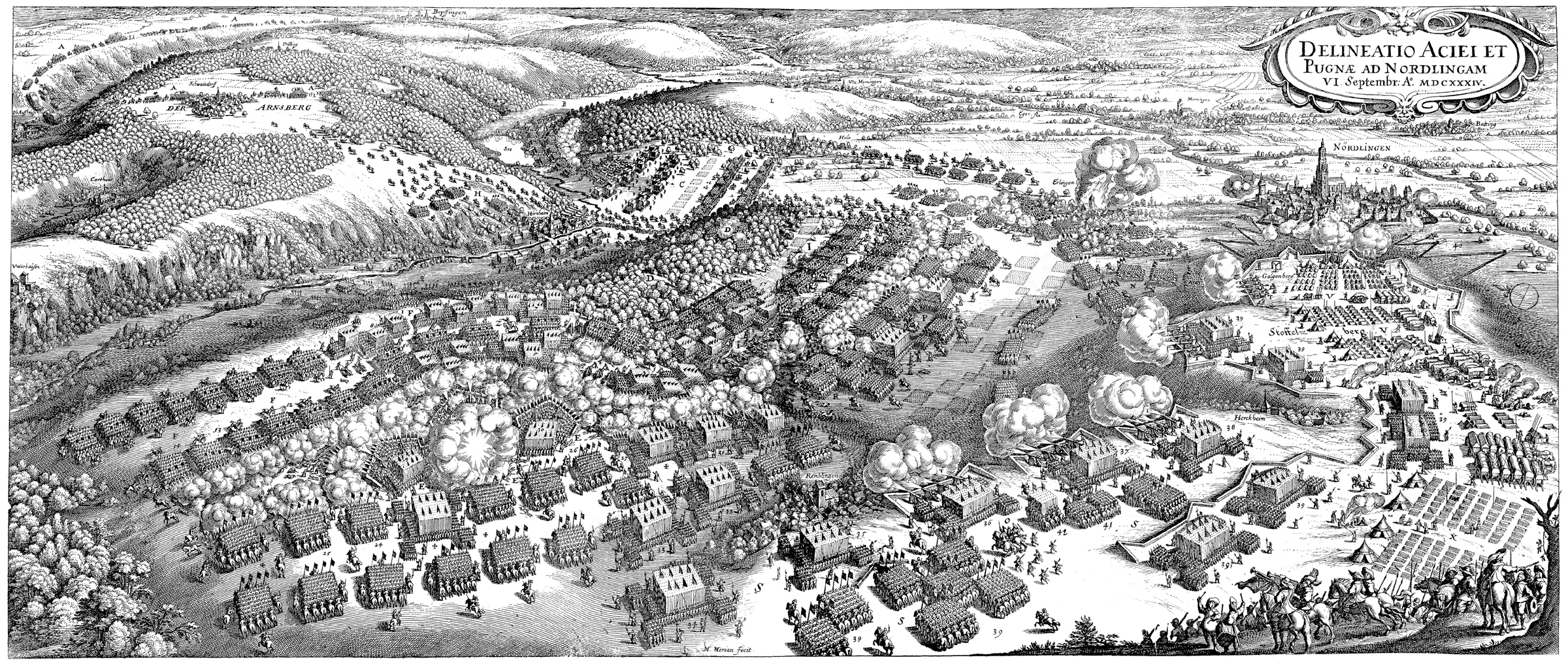 Gewalt- oder Geviert-Haufen,
unten Ordonnanz-Formationen
in: "Nördlingen - 1634",
Stich von Matthäus Merian.
(Quelle: ► Wikipedia)
 Schwedische und Spanische
Ordonnanz-Aufstellungen in:
"Lützen - 1632"
unbekannter Künstler
(Quelle: ► Wikipedia)
 Lineare Schlacht-Ordnung
in: "Schlacht bei Hohen-Friedberg am 4. Juni 1745 - Das Bataillon Grenadier-Garde." (IR Nr. 6)
Gemälde von ► Carl Röchling.
(Quelle: ► Eigene Sammlung)
 Schlacht-Plan
Leipzig, 18./19. Oktober 1813
Position der Armee-Korps
(Quelle: ► Wikipedia)
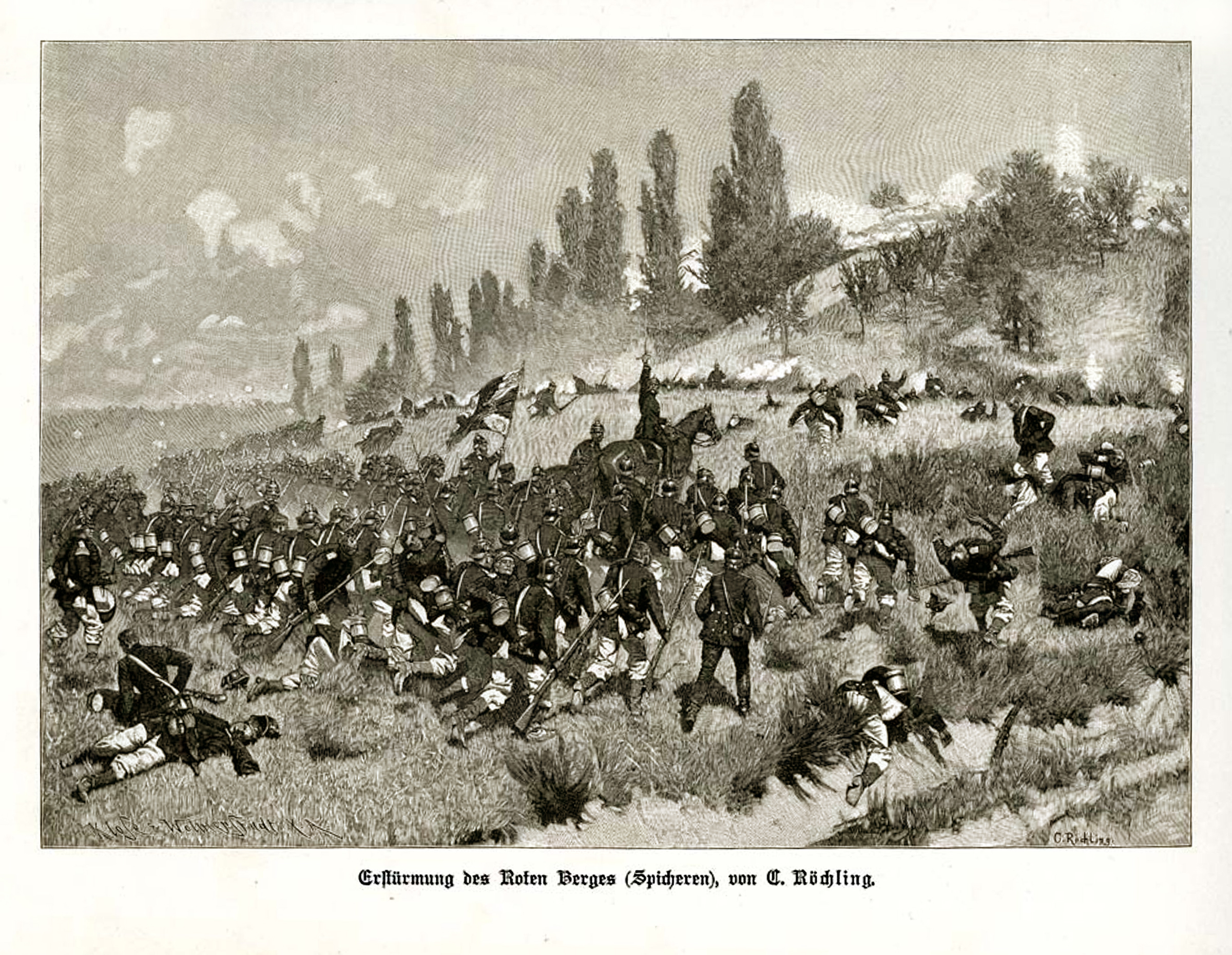 Kolonnen in Schlacht-Ordnung
in: "Erstürmung des Roten Berges" (Spichern - 6. August 1870)
Stich von ► Carl Röchling
(Quelle: Eigene Sammlung.)
|
SCH |
Schlag- und Stoß-Waffen
Schlag- und Stoß-Waffen bilden eine Ordnung des Komplexes der  Blank-Waffen. Blank-Waffen.
Als Schlag- und Stoß-Waffen kommen alle Arten von  Waffen oder waffenähnliche Gegenstände in Betracht, die die zertrümmernde Wirkung einer Waffen oder waffenähnliche Gegenstände in Betracht, die die zertrümmernde Wirkung einer  Schlag-Waffe mit der rammenden Wirkung einer Schlag-Waffe mit der rammenden Wirkung einer  Stoß-Waffe vereinen. Klassische Schlag- und Stoß-Waffen definieren sich somit als Gegenstände mit einem Schlag- oder Stoß-Kopf, der primär darauf ausgelegt ist, einen Körper mit "stumpfer Gewalt" zu prellen. Schlag- und Stoß-Waffen sind somit in der Form-Gebung zu diesen Zwecken gefertigt oder in der Handhabung für diese Zwecke verwendbar. Kurzschäftige Schlag- und Stoß-Waffen gehören in den Bereich der Stoß-Waffe vereinen. Klassische Schlag- und Stoß-Waffen definieren sich somit als Gegenstände mit einem Schlag- oder Stoß-Kopf, der primär darauf ausgelegt ist, einen Körper mit "stumpfer Gewalt" zu prellen. Schlag- und Stoß-Waffen sind somit in der Form-Gebung zu diesen Zwecken gefertigt oder in der Handhabung für diese Zwecke verwendbar. Kurzschäftige Schlag- und Stoß-Waffen gehören in den Bereich der  Kontakt-Waffen, langschäftige Schlag- und Stoß-Waffen werden den Kontakt-Waffen, langschäftige Schlag- und Stoß-Waffen werden den  Abstands- oder Abstands- oder  Stangen-Waffen zugeordnet. Stangen-Waffen zugeordnet.
Zur Ordnung der Schlag- und Stoß-Waffen gehören folgende Gruppen:
Da diverse Schlag- und Stoß-Waffen auch in Teilen zum  Hieb oder Hieb oder  Stich verwendet werden können, sind die Übergänge fließend. Stich verwendet werden können, sind die Übergänge fließend.
... mehr zum Thema:  KATEGORISIERUNG der Waffen KATEGORISIERUNG der Waffen
... siehe dazu ausführlich  WIKIPEDIA WIKIPEDIA
... zurück zum  Register Register
|
|
SCH |
Schlag-Waffen
Schlag-Waffen bilden eine Ordnung des Komplexes der  Blank-Waffen. Blank-Waffen.
Als Schlag-Waffen kommen alle Arten von  Waffen oder waffenähnliche Gegenstände in Betracht, die nach ihrer Konstruktion dazu bestimmt bzw. als stumpfe Objekte dazu geeignet sind, auf einen Körper mittels der von einer Person bei einer Schlag-Bewegung aufgewendeten Kraft spezifisch einzuwirken. Direkte oder indirekte Folge des Gebrauchs einer Schlag-Waffe sind Prellungen oder Zertrümmerungen. Kurzschäftige Schlag-Waffen gehören in den Bereich der Waffen oder waffenähnliche Gegenstände in Betracht, die nach ihrer Konstruktion dazu bestimmt bzw. als stumpfe Objekte dazu geeignet sind, auf einen Körper mittels der von einer Person bei einer Schlag-Bewegung aufgewendeten Kraft spezifisch einzuwirken. Direkte oder indirekte Folge des Gebrauchs einer Schlag-Waffe sind Prellungen oder Zertrümmerungen. Kurzschäftige Schlag-Waffen gehören in den Bereich der  Kontakt-Waffen, langschäftige Schlag-Waffen werden den Kontakt-Waffen, langschäftige Schlag-Waffen werden den  Abstands- oder Abstands- oder  Stangen-Waffen zugeordnet. Stangen-Waffen zugeordnet.
In der Regel wird ein Schlag durch eine bogenförmig-schwungvolle Aushol-Bewegung des waffen-führenden Arms (ähnlich einer  Wurf- oder Wurf- oder  Hieb-Bewegung) vorbereitet und anschließend durch eine bogenförmig-kraftvolle Bewegung ausgeführt, wobei der geübte Hieb-Bewegung) vorbereitet und anschließend durch eine bogenförmig-kraftvolle Bewegung ausgeführt, wobei der geübte  Angreifer bestrebt sein wird, den Schlag-Kopf seiner jeweiligen Schlag-Waffe schnell und mit Wucht auf einen möglichst ungedeckten und verletzlichen Bereich des gegnerischen Körpers zu lenken. Angreifer bestrebt sein wird, den Schlag-Kopf seiner jeweiligen Schlag-Waffe schnell und mit Wucht auf einen möglichst ungedeckten und verletzlichen Bereich des gegnerischen Körpers zu lenken.
Bei der waffentechnisch-physikalischen Betrachtung einer Schlag-Waffe ist der Umstand beachtenswert, dass je länger der Schaft einer Schlag-Waffe ist, desto größer die mit dem Schlag übertragene kinetische Energie und die dadurch verursachte Verletzung ist, wobei eine Schlag-Waffe mit zunehmender Schaft-Länge jedoch umso unhandlicher in der Handhabung wird.
Klassische Schlag-Waffen definieren sich somit als Gegenstände mit einem harten, relativ schweren, abgerundeten, stumpfen, stumpfkantigen oder breitflächigen Schlag-Kopf, der fest oder beweglich auf einem starren oder elastischen Schaft montiert ist. Die physischen Einwirkungen einer Schlag-Waffe werden als "stumpfe Gewalt" bezeichnet.
Zur Ordnung der Schlag-Waffen gehören folgende Gruppen:
Da diverse Schlag-Waffen auch zum Wurf,  Stich oder Stich oder  Stoß verwendet werden können, sind die Übergänge fließend. Hingegen werden Waffen, die zwar mit einer Schlag-Bewegung zum Einsatz gebracht werden, jedoch über geschliffene Klinge verfügen, als Hieb-Waffen bezeichnet. Stoß verwendet werden können, sind die Übergänge fließend. Hingegen werden Waffen, die zwar mit einer Schlag-Bewegung zum Einsatz gebracht werden, jedoch über geschliffene Klinge verfügen, als Hieb-Waffen bezeichnet.
... mehr zum Thema:  KATEGORISIERUNG der Waffen KATEGORISIERUNG der Waffen
... siehe dazu ausführlich  WIKIPEDIA WIKIPEDIA
... zurück zum  Register Register
|
 Schlag-Waffen (Montage);
Illustrationen u.a. aus
"Handbuch der Waffenkunde" von Wendelin Boeheim;
Verlag E.A. Seemann, Leipzig, 1890;
online verfügbar im:
► Deutschen Textarchiv
► zum Register des Handbuchs...
|
SCH |
Schleuder-Waffen
Schleuder-Waffen bilden eine Ordnung des Komplexes der  Blank-Waffen. Blank-Waffen.
Als Schleuder-Waffen kommen alle Arten von  Waffen oder waffenähnliche Gegenstände in Betracht, die nach ihrer Konstruktion dazu bestimmt bzw. als massive Objekte dazu geeignet sind, auf einen Körper mittels der von einer Person nach Freigabe aus einer von Hand bewegten Schleuder-Vorrichtung übertragenen Kraft spezifisch einzuwirken. Direkte oder indirekte Folge des Gebrauchs von Schleuder-Waffen sind Prellungen und/oder Zertrümmerungen, aber auch Penetrationen, in Ausnahmen aber auch biologische, chemische und thermische Verletzungen bzw. Wirkungen aber auch Knall- und Explosions-Traumatas. Durch die Komponenten Schleuder und Geschoss gehören Schleuder-Waffen in den Bereich der Waffen oder waffenähnliche Gegenstände in Betracht, die nach ihrer Konstruktion dazu bestimmt bzw. als massive Objekte dazu geeignet sind, auf einen Körper mittels der von einer Person nach Freigabe aus einer von Hand bewegten Schleuder-Vorrichtung übertragenen Kraft spezifisch einzuwirken. Direkte oder indirekte Folge des Gebrauchs von Schleuder-Waffen sind Prellungen und/oder Zertrümmerungen, aber auch Penetrationen, in Ausnahmen aber auch biologische, chemische und thermische Verletzungen bzw. Wirkungen aber auch Knall- und Explosions-Traumatas. Durch die Komponenten Schleuder und Geschoss gehören Schleuder-Waffen in den Bereich der  bedingten bedingten  Distanz-Waffen. Distanz-Waffen.
Das Schleudern ist eine verstärkte  Wurf-Bewegung. Waffen-technisch setzt das Schleudern neben einem zu schleudernden Wurf-Bewegung. Waffen-technisch setzt das Schleudern neben einem zu schleudernden
 Geschoss eine Konstruktion voraus (Bedingung), die es ermöglicht, die Bewegung des waffen-führenden Armes auf das zu schleudernde Objekt zu übertragen, wobei menschliche Kraft in mechanische Energie umgewandelt wird. Die Verstärkung des manuellen Schwunges kann mittels einer Schlinge, einer Schlaufe oder einer starren oder biegsamen Verlängerung des Wurf-Armes erreicht werden. Hierbei kommt bei einer schnellen Rotation die Flieh- bzw. Zentrifugal-Kraft -, beim schwungvollen Katapultieren mit einem festen Schleuder-Arm die Zug- und Hebel-Kraft – und beim Katapultieren mit einem elastischen Schleuder-Arm die Feder-Kraft unterstützend zur Wirkung, wobei alle Schleuder-Arten auch den
Geschoss eine Konstruktion voraus (Bedingung), die es ermöglicht, die Bewegung des waffen-führenden Armes auf das zu schleudernde Objekt zu übertragen, wobei menschliche Kraft in mechanische Energie umgewandelt wird. Die Verstärkung des manuellen Schwunges kann mittels einer Schlinge, einer Schlaufe oder einer starren oder biegsamen Verlängerung des Wurf-Armes erreicht werden. Hierbei kommt bei einer schnellen Rotation die Flieh- bzw. Zentrifugal-Kraft -, beim schwungvollen Katapultieren mit einem festen Schleuder-Arm die Zug- und Hebel-Kraft – und beim Katapultieren mit einem elastischen Schleuder-Arm die Feder-Kraft unterstützend zur Wirkung, wobei alle Schleuder-Arten auch den
 ballistischen Kräften unterliegen. Der geübte
ballistischen Kräften unterliegen. Der geübte  Angreifer wird dabei bestrebt sein, das zu schleudernde Objekt in dem Moment freizugeben, in dem der Masse-Schwerpunkt im Ideal-Fall einer parabel-ähnlichen Flug-Bahn folgen kann, die auf das Ziel führt. Die eigentliche Flug-Bewegung kann dabei entweder taumelnd (bspw. Stein), gerade (bspw. Angreifer wird dabei bestrebt sein, das zu schleudernde Objekt in dem Moment freizugeben, in dem der Masse-Schwerpunkt im Ideal-Fall einer parabel-ähnlichen Flug-Bahn folgen kann, die auf das Ziel führt. Die eigentliche Flug-Bewegung kann dabei entweder taumelnd (bspw. Stein), gerade (bspw.
 Speer) oder rotierend (bspw. Bola) sein.
Speer) oder rotierend (bspw. Bola) sein.
Bei der waffentechnisch-physikalischen Betrachtung von Schleuder-Waffen sind neben der Aerodynamik drei grundsätzliche Aspekte beachtenswert:
- Die Flug-Bahn gerader Schleuder-Waffen wird direkt von Masse und Schwerpunkt, Auftrieb, Wind und Luft-Widerstand beeinflusst.
- Die Flug-Bahn taumelnder Schleuder-Waffen wird von jeweiliger Unwucht, Masse und Form sowie Luft-Widerstand beeinflusst.
- Rotierende Schleuder-Waffen werden auf ihrer Flug-Bahn durch die Drehung um ihre jeweilige Symmetrie-Achse stabilisiert, die quer zur Flug-Richtung steht. Die Flug-Bahn wird dabei durch Auf- oder Abtrieb, Wind und Luft-Widerstand beeinflusst.
Klassische Schleuder-Objekte oder -Geschosse definieren sich somit als Gegenstände mit Kriterien diverser Waffen-Ordnungen: Geschleuderte Objekte können nicht nur aus unterschiedlichsten Materialien in einem Stück in vielfältigsten Formen gefertigte "Waffen an sich" sein, sondern auch mit stumpfen, spitzen und/oder scharfen Klingen versehen werden, die in der Regel fest oder beweglich montiert sind. Die physischen Einwirkungen einer Schleuder-Waffe können somit "scharfer und/oder stumpfer Gewalt" sein.
Zur Ordnung der klassischen Schleuder-Waffen gehören folgende Gruppen:
Da diverse Schleuder-Objekte bzw. Geschosse auch separat zum  Stich, Stich,  Hieb oder Hieb oder  Schlag verwendet werden können, sind die Übergänge fließend. Hingegen werden Waffen, die ein Geschoss mittels der Spannung einer elastischen Sehne transportieren, als Schlag verwendet werden können, sind die Übergänge fließend. Hingegen werden Waffen, die ein Geschoss mittels der Spannung einer elastischen Sehne transportieren, als
 Spann- bzw. Vorspann-Waffen bezeichnet. Größere Schleuder-Waffen, die eine mehrköpfige
Spann- bzw. Vorspann-Waffen bezeichnet. Größere Schleuder-Waffen, die eine mehrköpfige
 Bedienung erfordern und/oder auf einer
Bedienung erfordern und/oder auf einer
 Lafette montiert sind, werden als
Lafette montiert sind, werden als
 Katapult- bzw. Schleuder-Geschütze bezeichnet.
Katapult- bzw. Schleuder-Geschütze bezeichnet.
... mehr zum Thema:  KATEGORISIERUNG der Waffen KATEGORISIERUNG der Waffen
... siehe dazu ausführlich  WIKIPEDIA WIKIPEDIA
... zurück zum  Register Register
|
 Stock-Schleuder und römischer Schleuderer (funditor)
(Illustration aus: "Meyers-Konversationslexikon"; 7. Auflage, 1924) |
SCH |
Schnäpper (auch "Schnepper" oder "Schneller")
Volkstümliche Bezeichnung für die leichtere Version der  Armbrust; auch Armbrust; auch  "Schneller" genannt. "Schneller" genannt.
... zurück zum  Register Register
|
|
SCH |
Schneller
waffen-technisch
In der der  Kategorisierung der Waffen eine Kategorisierung der Waffen eine  Waffe vom Typ der Waffe vom Typ der
 Vorspann-Waffen; in der Art einer leichten
Vorspann-Waffen; in der Art einer leichten  Armbrust. Armbrust.
militär-spezifisch
Als "Schneller" wurden in der frühen deutschen
 Artillerie (siehe dazu
Artillerie (siehe dazu  Arkeley) die Handlager bezeichnet, die im Unterschied zu den spezialisierten Arkeley) die Handlager bezeichnet, die im Unterschied zu den spezialisierten  Stück-Knechten die groben Arbeiten an einem Stück-Knechten die groben Arbeiten an einem
 Wurf-Geschütz verrichteten. Vor einem
Wurf-Geschütz verrichteten. Vor einem
 Gefecht hatten die Schneller die Aufgabe, auf dem unter bestimmten Kriterien ausgewählten Stell-Platz alle nötigen Vorbereitungen für die Montage und den Einsatz eines
Gefecht hatten die Schneller die Aufgabe, auf dem unter bestimmten Kriterien ausgewählten Stell-Platz alle nötigen Vorbereitungen für die Montage und den Einsatz eines
 Geschützes zu treffen. Während des Einsatzes hatten die Schneller das sog. Hebe- oder Spann-Zeug zu bedienen (siehe dazu auch
Geschützes zu treffen. Während des Einsatzes hatten die Schneller das sog. Hebe- oder Spann-Zeug zu bedienen (siehe dazu auch
 Torsions- bzw.
Torsions- bzw.
 Flexions-Geschütze), für die Heranschaffung bzw. Bereitstellung der erforderlichen
Flexions-Geschütze), für die Heranschaffung bzw. Bereitstellung der erforderlichen
 Munition zu sorgen und sonstige schwere Lasten zu bewegen, zu heben und zu tragen. Kommandiert wurden die Hilfs-Kräfte üblicherweise von den als
Munition zu sorgen und sonstige schwere Lasten zu bewegen, zu heben und zu tragen. Kommandiert wurden die Hilfs-Kräfte üblicherweise von den als
 Geschütz-Führer fungierenden
Geschütz-Führer fungierenden  Stück-Junkern; mit dem Übergang zur pyrotechnisch-feuernden Stück-Junkern; mit dem Übergang zur pyrotechnisch-feuernden
 Rohr-Waffen dann von den
Rohr-Waffen dann von den  Konstablern. Konstablern.
Gegen Zahlung eines Hand-Geldes wurden die Schneller von den
 Büchsen- und/oder
Büchsen- und/oder  Stück-Meistern einer Stadt aus den untersten Schichten der bürgerlichen Bevölkerung Stück-Meistern einer Stadt aus den untersten Schichten der bürgerlichen Bevölkerung
 angeworben oder angestellt und waren im Fall einer
angeworben oder angestellt und waren im Fall einer
 Belagerung vor oder innerhalb einer
Belagerung vor oder innerhalb einer
 Befestigung
Befestigung
 dienst-verpflichtet. In Anlehnung an die "Gepflogenheiten"
dienst-verpflichtet. In Anlehnung an die "Gepflogenheiten"  mittelalterlicher mittelalterlicher
 Zunft-Ordnungen gehörten die Schneller in der Regel zwar längerfristig oder dauerhaft der
Zunft-Ordnungen gehörten die Schneller in der Regel zwar längerfristig oder dauerhaft der
 Bedienung eines Geschützes an, zählten jedoch im Feld-Einsatz bzw. im
Bedienung eines Geschützes an, zählten jedoch im Feld-Einsatz bzw. im
 Heer der
Heer der
 Landsknechte als Angehörige der Artillerie gleich den
Landsknechte als Angehörige der Artillerie gleich den
 Fuhr- und
Fuhr- und
 Schanz-Knechten nicht zu den
Schanz-Knechten nicht zu den
 Kombattanten. Trotzdem hatten bspw. die in der "Zunft der Blyderer" organisierten Schneller Anspruch auf die Zahlung des "Anderhalp" (von althochdeutsch "ander": das Zweite; somit "anderhalb": das Zweite zur Hälfte) und erhielten damit den anderthalb-fachen
Kombattanten. Trotzdem hatten bspw. die in der "Zunft der Blyderer" organisierten Schneller Anspruch auf die Zahlung des "Anderhalp" (von althochdeutsch "ander": das Zweite; somit "anderhalb": das Zweite zur Hälfte) und erhielten damit den anderthalb-fachen
 Sold eines altgedienten Lands-Knechtes, der monatlich zwischen 3 bis 4 Gulden empfing.
Sold eines altgedienten Lands-Knechtes, der monatlich zwischen 3 bis 4 Gulden empfing.
Mit dem Aufkommen der
 "Stehenden Heere" und der europa-weiten Errichtung der Artillerie als neue
"Stehenden Heere" und der europa-weiten Errichtung der Artillerie als neue
 militärische
militärische
 Truppen-Gattung der gingen die Schneller und Stück-Knechte in den
Truppen-Gattung der gingen die Schneller und Stück-Knechte in den
 Artilleristen auf.
Artilleristen auf.
... zurück zum  Register Register
|
 "Mangone" um 1150
Schweres Wurf-Geschütz ähnlich der Blide, deren Schleuder-Kraft nach dem Hebelarm-Prinzip generiert wird. Gut zu erkennen die zahlreichen Mitglieder der Mannschaft, die zur Bedienung nötig war.
Der Überlieferung nach lernten die Kreuz-Fahrer schwere Wurf-Geschütze dieser Art erstmals bei der Belagerung von Tyros im Jahr 1124 kennen und zu bedienen. König Eduards III. von England setzte Wurf-Geschütze im Jahr 1346 bei der Belagerung von Calais in Stellung.
Illustrationen von E. Guillaumot aus "Grundlegendes Wörterbuch der französischen Architektur vom 11. bis 16. Jahrhundert" von Eugène Viollet-le-Duc.
(Quelle: ► Bayerische Staatsbibliothek;)
|
SCH |
Schuss-Waffen
Schuss-Waffen bilden neben den  Blank-Waffen einen Komplex des Gebietes der sogenannten Blank-Waffen einen Komplex des Gebietes der sogenannten  Gebrauchs-Waffen. Gebrauchs-Waffen.
Als Schuss-Waffen kommen alle Arten von  Waffen oder waffenähnliche Gegenstände in Betracht, die aufgrund ihrer technischen Konstruktion dazu geeignet sind, Waffen oder waffenähnliche Gegenstände in Betracht, die aufgrund ihrer technischen Konstruktion dazu geeignet sind,
 Geschosse oder
Geschosse oder
 Projektile (siehe dazu
Projektile (siehe dazu
 Munition) energetisch zu beschleunigen und über eine gewisse Entfernung in Form einer
Munition) energetisch zu beschleunigen und über eine gewisse Entfernung in Form einer
 ballistischen Kurve gezielt zu verschießen. Spezifische bzw. direkte oder indirekte Wirkungen der jeweils verwendeten Munition sind neben dem Auftreffen das Ein- und/oder Durchdringen des Ziel-Mediums. Aufgrund ihrer Verwendung im Kampf "Mann gegen Mann" können Schuss-Waffen auch nach Reich-Weiten klassifiziert werden. Zu unterscheiden sind hier die Bereiche der
ballistischen Kurve gezielt zu verschießen. Spezifische bzw. direkte oder indirekte Wirkungen der jeweils verwendeten Munition sind neben dem Auftreffen das Ein- und/oder Durchdringen des Ziel-Mediums. Aufgrund ihrer Verwendung im Kampf "Mann gegen Mann" können Schuss-Waffen auch nach Reich-Weiten klassifiziert werden. Zu unterscheiden sind hier die Bereiche der  Distanz-Waffen und der Distanz-Waffen und der  Nahbereichs-Waffen. Nahbereichs-Waffen.
Als Gebrauchs-Waffen gehören Schuss-Waffen zu den  Hand- (oder Nah-Kampf-) Waffen. Schuss-Waffen definieren sich über die Weise der Handhabung bzw. über den eigentlichen Zweck oder die Möglichkeiten der manuellen Verwendung (bspw. kann eine Schuss-Waffe, die praktisch für den gezielten Schuss bestimmt ist, auch zum Hand- (oder Nah-Kampf-) Waffen. Schuss-Waffen definieren sich über die Weise der Handhabung bzw. über den eigentlichen Zweck oder die Möglichkeiten der manuellen Verwendung (bspw. kann eine Schuss-Waffe, die praktisch für den gezielten Schuss bestimmt ist, auch zum  Schlagen oder Schlagen oder  Stoßen bzw. durch die Montage eines Stoßen bzw. durch die Montage eines
 Bajonetts auch zum
Bajonetts auch zum  Stechen geeignet sein). Somit sind die Übergänge fließend. Hingegen werden Schuss-Waffen ab einem Stechen geeignet sein). Somit sind die Übergänge fließend. Hingegen werden Schuss-Waffen ab einem
 Kaliber von 20mm der
Kaliber von 20mm der
 Artillerie und somit dem Gebiet der
Artillerie und somit dem Gebiet der
 Kriegs-Waffen zugeordnet.
Kriegs-Waffen zugeordnet.
Zu unterscheiden sind demnach folgende Ordnungen:
Je nach Verwendung oder Bestimmung können Schuss-Waffen zu Zwecken des  Angriffs oder der Angriffs oder der
 Verteidigung, der
Verteidigung, der
 Signal-Gebung, zur Jagd oder im Rahmen des sportlichen Trainings oder Wettkampfes zum Einsatz kommen.
Signal-Gebung, zur Jagd oder im Rahmen des sportlichen Trainings oder Wettkampfes zum Einsatz kommen.
Anmerkung: Obwohl technisch eindeutig bestimmbar, ist die juristische Zuordnung eines
 Bogens in Deutschland beachtlich. Laut
Bogens in Deutschland beachtlich. Laut  Anlage 1 Punkt 1.2.2. zum WaffG (zu Paragraph § 1 Absatz 4 WaffG) werden Gegenstände "... bei denen bestimmungsgemäß feste Körper gezielt verschossen werden, deren Antriebs-Energie durch Muskel-Kraft eingebracht und durch eine Sperr-Vorrichtung gespeichert werden kann (z. B. Armbrüste)..." den Schuss-Waffen zugeordnet. Nach dieser Definition gehört der Bogen juristisch gegenwärtig nicht zum Komplex der Schuss-Waffen. Anlage 1 Punkt 1.2.2. zum WaffG (zu Paragraph § 1 Absatz 4 WaffG) werden Gegenstände "... bei denen bestimmungsgemäß feste Körper gezielt verschossen werden, deren Antriebs-Energie durch Muskel-Kraft eingebracht und durch eine Sperr-Vorrichtung gespeichert werden kann (z. B. Armbrüste)..." den Schuss-Waffen zugeordnet. Nach dieser Definition gehört der Bogen juristisch gegenwärtig nicht zum Komplex der Schuss-Waffen.
... mehr zum Thema:  KATEGORISIERUNG der Waffen KATEGORISIERUNG der Waffen
... siehe dazu ausführlich  WIKIPEDIA WIKIPEDIA
... zurück zum  Register Register
|

Ein Armbrust-Schütze deckt seine Kameraden, die wahrscheinlich einen Ramm-Bock herantragen. Und obwohl den Christen der Gebrauch der Armbrust von Papst Innozenz II. auf dem 2. Lateran-Konzil im Jahr 1139 verboten worden war, gestattete er hingegen die Verwendung im Rahmen der Kreuz-Züge gegen die Ungläubigen.
Illustration aus
"Handbuch der Waffenkunde" von Wendelin Boeheim;
Verlag E.A. Seemann, Leipzig, 1890. Online verfügbar im ► "Deutschen Textarchiv".
|
SCH |
Schutz-Waffen
Als Schutz-Waffen werden alle Arten von Gegenstände bezeichnet, die zu dem Zweck gefertigt wurden oder dazu geeignet sind, die spezifische Wirkung von
 Waffen auf einen Körper abzufangen, teilweise zu mildern oder vollständig zu verhindern, jedoch nicht zu einem direkten Waffen auf einen Körper abzufangen, teilweise zu mildern oder vollständig zu verhindern, jedoch nicht zu einem direkten  Angriff geeignet sind. Schutz-Waffen dienen somit primär der Abwendung von Sach-, Körper- und/oder Personen-Schäden bzw. dem Schutz vor Verletzungen und somit der Angriff geeignet sind. Schutz-Waffen dienen somit primär der Abwendung von Sach-, Körper- und/oder Personen-Schäden bzw. dem Schutz vor Verletzungen und somit der
 Verteidigung; sekundär zur unbeschadet vorgetragenen Ausführung eines Angriffs.
Verteidigung; sekundär zur unbeschadet vorgetragenen Ausführung eines Angriffs.
Seit der  Antike ging die Herstellung der Waffen mit der Entwicklung entsprechender Schutz-Waffen einher, die in erster Hinsicht mit der Zielsetzung gefertigt wurden, den menschlichen Körper in Teilen oder in Gänze zu bedecken, wobei die technische Konstruktion darauf ausgelegt sein sollte, in der Praxis weitestgehenden Schutz vor möglichst vielen Arten von Antike ging die Herstellung der Waffen mit der Entwicklung entsprechender Schutz-Waffen einher, die in erster Hinsicht mit der Zielsetzung gefertigt wurden, den menschlichen Körper in Teilen oder in Gänze zu bedecken, wobei die technische Konstruktion darauf ausgelegt sein sollte, in der Praxis weitestgehenden Schutz vor möglichst vielen Arten von  Gebrauchs- bzw. Gebrauchs- bzw.  Hand- (oder Nah-Kampf-) Waffen zu gewährleisten, ohne dabei die Beweglichkeit bzw. die Mobilität des Trägers einer Schutz-Waffe (bspw. im Rahmen eines Hand- (oder Nah-Kampf-) Waffen zu gewährleisten, ohne dabei die Beweglichkeit bzw. die Mobilität des Trägers einer Schutz-Waffe (bspw. im Rahmen eines
 Zwei-Kampfes) zu behindern.
Zwei-Kampfes) zu behindern.
Im  Mittelalter unterschied man im deutsch-sprachigen Raum zwischen der s.g. Mittelalter unterschied man im deutsch-sprachigen Raum zwischen der s.g.  Trutz-Waffen, die ausschließlich für einen Angriff geeignet waren, und den Schutz-Waffen, die vor eben diesen schützen sollten. Die Kombination von Schutz- und Trutz-Waffen wurde als "Rüstzeug" bezeichnet, das wiederum zusammen mit der Trutz-Waffen, die ausschließlich für einen Angriff geeignet waren, und den Schutz-Waffen, die vor eben diesen schützen sollten. Die Kombination von Schutz- und Trutz-Waffen wurde als "Rüstzeug" bezeichnet, das wiederum zusammen mit der
 Rüstung eines
Rüstung eines
 Ritters bspw. in der
Ritters bspw. in der
 "Rüstkammer" eines schützenden Bauwerks (siehe dazu
"Rüstkammer" eines schützenden Bauwerks (siehe dazu
 Befestigungen) aufbewahrt bzw. bereitgehalten wurde.
Befestigungen) aufbewahrt bzw. bereitgehalten wurde.
Wichtigste Komponenten der klassischen Schutz-Waffen waren:
Mit dem Aufkommen der
 Feuer-Waffen im 14. Jahrhundert und der baldigen Entwicklung und Verbreitung immer effektiverer Arten von
Feuer-Waffen im 14. Jahrhundert und der baldigen Entwicklung und Verbreitung immer effektiverer Arten von
 Hand- und
Hand- und
 Faust-Feuer-Waffen, insbesondere der
Faust-Feuer-Waffen, insbesondere der
 Artillerie-Geschütze, verloren die klassischen ritterlichen Schutz-Waffen zunehmend ihre Schutz-Funktion, somit an militärischer Bedeutung und wurden spätestens ab dem 16. Jahrhundert nur noch aus Prestige-, Repräsentations- oder Status-Gründen angelegt. Hingegen erwiesenen sich einzelne "Schutz-Stücke" in modifizierter Form weiterhin geeignet, um der Wirkung diverser Arten von
Artillerie-Geschütze, verloren die klassischen ritterlichen Schutz-Waffen zunehmend ihre Schutz-Funktion, somit an militärischer Bedeutung und wurden spätestens ab dem 16. Jahrhundert nur noch aus Prestige-, Repräsentations- oder Status-Gründen angelegt. Hingegen erwiesenen sich einzelne "Schutz-Stücke" in modifizierter Form weiterhin geeignet, um der Wirkung diverser Arten von  Blank-Waffen widerstehen zu können. Blank-Waffen widerstehen zu können.
Die legendären Ritter wandelten sich in die s.g. "Kürissers", besser bekannt als
 Kürassiere.
Kürassiere.
Erwiesen sich klassische Schutz-Waffen in den Kriegen des endenden 19. und frühen 20. Jahrhunderts bis auf den "Stahlhelm" als vollkommen ineffektiv, so führte die Entwicklung neuartiger Werkstoffe wie Keramik, Plastik, Polyamid- oder Carbon-Fasern ab den sechziger Jahren zur Einführung innovativer Schutz-Waffen wie diverse moderne Gefechts- oder Einsatz-Helme samt geeigneter Schutz-Masken, schlag-, schuss-, splitter- bzw. stich-hemmende Schutz-Westen samt Protektoren bzw. s.g. Exo-Skelette.
In der Bundesrepublik Deutschland bilden Schutz-Waffen bzw. dazu geeignete Gegenstände seit 1989 laut  § 17a Versammlungsgesetz (VersG) ein besonderes Gebiet der Waffen. Hinter-Grund dieser Gesetz-Gebung ist die Zielsetzung, staatlichen Hoheits-Kräften rechtssichere Möglichkeiten zu verschaffen, Identifizierungs- und/oder Vollstreckungs-Maßnahmen einleiten und durchführen zu können, die von den ausgemachten Delinquenten nicht durch passiven oder aktiven Widerstand behindert oder eingeschränkt bzw. durch das Tragen von Schutz-Waffen abgewehrt werden können. In diesem Sinne kommen als Schutz-Waffen bzw. s.g. Schutz-Stücke alle Gegenstände in Betracht, die zwar nicht zu einem Angriff oder zur Zufügung von Verletzungen geeignet sind, aber vor Beeinträchtigungen bzw. Verletzungen schützen. Dazu gehören bspw. schnittfeste Handschuhe, Motorad- bzw. Integral-Helme, Atem- bzw. Gesichts-Schutzmasken, Leder-Kombinationen, Schutzwesten oder improvisierte Körper-Panzerungen aller Art. § 17a Versammlungsgesetz (VersG) ein besonderes Gebiet der Waffen. Hinter-Grund dieser Gesetz-Gebung ist die Zielsetzung, staatlichen Hoheits-Kräften rechtssichere Möglichkeiten zu verschaffen, Identifizierungs- und/oder Vollstreckungs-Maßnahmen einleiten und durchführen zu können, die von den ausgemachten Delinquenten nicht durch passiven oder aktiven Widerstand behindert oder eingeschränkt bzw. durch das Tragen von Schutz-Waffen abgewehrt werden können. In diesem Sinne kommen als Schutz-Waffen bzw. s.g. Schutz-Stücke alle Gegenstände in Betracht, die zwar nicht zu einem Angriff oder zur Zufügung von Verletzungen geeignet sind, aber vor Beeinträchtigungen bzw. Verletzungen schützen. Dazu gehören bspw. schnittfeste Handschuhe, Motorad- bzw. Integral-Helme, Atem- bzw. Gesichts-Schutzmasken, Leder-Kombinationen, Schutzwesten oder improvisierte Körper-Panzerungen aller Art.
... mehr zum Thema:  KATEGORISIERUNG der Waffen KATEGORISIERUNG der Waffen
... siehe dazu ausführlich  WIKIPEDIA WIKIPEDIA
... zurück zum  Register Register
|


|
SCH

29. September 1364 - Hundertjähriger Krieg: "La Bataille d'Auray" ("Quadrae" der französischen und englischen Ritter in der Attacke).
Illustration von Loyset Liédet in den »Chroniques de France« von Jean Froissart um 1370.
(Quelle ► »Bibliothèque nationale de France« (BnF; Paris, FRA).

Schwadron in der Attacke
"The 6th Inniskilling Dragoons"
Aquarell von ►
Richard Simkin in der ► »Anne S. K. Brown Military Collection« (Brown University Library, Providence, Rhode Island, USA).

Schwadron in der Attacke
"Scotland Forever!" (Die "Scots Greys" bei ► Waterloo)
Gemälde von ► Elizabeth (Thompson) Butler in der ► »Bridgeman Art Library« (Leeds Museums and Galleries; Leeds, West Yorkshire, UK).
|
Schwadron (auch  Eskadron) Eskadron)
(engl.: Squadron; franz.: Escadron; russ.: Эскадрон)
Allgemein versteht man unter einer Schwadron eine  Teil-Einheit der Teil-Einheit der
 Kavallerie, die hierarchisch zwischen der
Kavallerie, die hierarchisch zwischen der  Kompanie und dem Kompanie und dem  Regiment -, in Ausnahmen auch dem Regiment -, in Ausnahmen auch dem  Bataillon oder der Bataillon oder der  Division eingeordnet wird. Division eingeordnet wird.
Der Begriff Schwadron ist eine deutsche Ableitung des italienischen "Squadrone" (lat.: Quadra: Karo, Quadrat, Karree bzw. Exquadra: Schlacht-Haufen, davon ital.: Squadra: Gruppe oder Trupp; daraus port.: Esquadro; Fläche, Raute). Die Schwadron ist etymologisch somit gleichzusetzen mit der im deutschen, skandinavischen und slawischen Sprach-Raum verbreiteten Eskadron. Die Bezeichnung geht historisch zurück auf die sogenannte
 Haufen-Taktik des späten
Haufen-Taktik des späten  Mittelalters und bezeichnete hier eine Aufteilung der Mittelalters und bezeichnete hier eine Aufteilung der  Schlacht-Ordnung in einzelne Schlacht-Ordnung in einzelne
 Schlacht-Haufen. Die Kavallerie, die in der Regel die
Schlacht-Haufen. Die Kavallerie, die in der Regel die
 Flügel der klassischen
Flügel der klassischen
 Linear-Formation mit bis zu siebzehn (!) Gliedern tiefen
Linear-Formation mit bis zu siebzehn (!) Gliedern tiefen  Aufstellungen zu decken hatte, fand mit dem Aufkommen der Aufstellungen zu decken hatte, fand mit dem Aufkommen der
 Feuer-Waffen mehr und mehr als schnell-bewegliche
Feuer-Waffen mehr und mehr als schnell-bewegliche
 Reserve Verwendung und wurde aus diesem Grund ebenfalls in
Reserve Verwendung und wurde aus diesem Grund ebenfalls in
 taktische Teil-Einheiten untergliedert. Ab dem
taktische Teil-Einheiten untergliedert. Ab dem  Dreißigjährigen Krieg unterteilten sich europaweit beinahe alle Dreißigjährigen Krieg unterteilten sich europaweit beinahe alle
 Lanzier-,
Lanzier-,
 Dragoner- und
Dragoner- und
 Kürassier-Regimenter samt den aufkommenden
Kürassier-Regimenter samt den aufkommenden
 "Huszári" (Husaren) in Schwadronen oder Eskadronen.
"Huszári" (Husaren) in Schwadronen oder Eskadronen.
Seit dem 16. Jahrhundert verbreitete sich der Begriff vor allem in den  Armeen Spaniens und Portugals und etablierte sich annehmbar während der diversen englisch-spanischen Konflikte zwischen 1559 und 1604 auch in der Armeen Spaniens und Portugals und etablierte sich annehmbar während der diversen englisch-spanischen Konflikte zwischen 1559 und 1604 auch in der
 englischen und späteren britischen Armee. Hier galt die "Squadron" anfänglich als Bezeichnung für ein kleines
englischen und späteren britischen Armee. Hier galt die "Squadron" anfänglich als Bezeichnung für ein kleines
 Karree der
Karree der
 Infanterie, wurde dann auch von der Kavallerie übernommen und hier Bezeichnung einer Unter-Einheit eines Regiments von unbestimmter Stärke. Bis 1776 konnte die "Squadron" einerseits von zwei bis vier Kompanien gebildet -, andererseits mit einer Kompanie gleichgesetzt werden. Ab 1788 wurde die britische Schwadron in zwei "Troops" gegliedert, die vom jeweils dienst-älteren bzw.
Infanterie, wurde dann auch von der Kavallerie übernommen und hier Bezeichnung einer Unter-Einheit eines Regiments von unbestimmter Stärke. Bis 1776 konnte die "Squadron" einerseits von zwei bis vier Kompanien gebildet -, andererseits mit einer Kompanie gleichgesetzt werden. Ab 1788 wurde die britische Schwadron in zwei "Troops" gegliedert, die vom jeweils dienst-älteren bzw.
 "Senior-Captain" kommandiert wurde. Während der sogenannten
"Senior-Captain" kommandiert wurde. Während der sogenannten
 Halbinsel-Kriege zwischen 1809 und 1814 verfügte ein Troop etat-mäßig über einen Captain, zwei
Halbinsel-Kriege zwischen 1809 und 1814 verfügte ein Troop etat-mäßig über einen Captain, zwei
 "Lieutenants", einen
"Lieutenants", einen
 "Cornet", einen
"Cornet", einen
 "Sergeant-Major", einen
"Sergeant-Major", einen
 "Furrier", vier
"Furrier", vier
 "Sergeants", vier
"Sergeants", vier
 "Corporals", einen
"Corporals", einen
 "Trumpeter" und mindestens fünfundachtzig "Troopers" - zusammen hundert Mann. Bei
"Trumpeter" und mindestens fünfundachtzig "Troopers" - zusammen hundert Mann. Bei
 Waterloo lag die durchschnittliche Stärke einer Schwadron zu zwei Troops bei etwa hundertachtzig Mann; zwei bis vier Schwadronen bildeten ein Regiment, das von einem
Waterloo lag die durchschnittliche Stärke einer Schwadron zu zwei Troops bei etwa hundertachtzig Mann; zwei bis vier Schwadronen bildeten ein Regiment, das von einem
 "Lieutenant-Colonel" kommandiert wurde, dem auch die
"Lieutenant-Colonel" kommandiert wurde, dem auch die
 Depot-Schwadron unterstand. Jede Schwadron führte eine
Depot-Schwadron unterstand. Jede Schwadron führte eine
 Standarte, wobei die erste Schwadron die sogenannte "King´s Standard" (siehe dazu
Standarte, wobei die erste Schwadron die sogenannte "King´s Standard" (siehe dazu
 King´s Color) präsentierte, alle weiteren Schwadronen ein sogenanntes "Regimental guidon" (siehe dazu
King´s Color) präsentierte, alle weiteren Schwadronen ein sogenanntes "Regimental guidon" (siehe dazu
 Regimental Color) zeigten.
Regimental Color) zeigten.
Die Kavallerie-Regimenter der
 US-Army waren in der Regel in zehn bis zwölf Kompanien (auch als "Troops" bezeichnet) unterteilt, die (unter Ausnahme des Buchstabens "J", der handschriftlich mit dem Buchstaben "I" verwechselt werden konnte) alphabetisch von "A" bis "M" benannt und nur in der
US-Army waren in der Regel in zehn bis zwölf Kompanien (auch als "Troops" bezeichnet) unterteilt, die (unter Ausnahme des Buchstabens "J", der handschriftlich mit dem Buchstaben "I" verwechselt werden konnte) alphabetisch von "A" bis "M" benannt und nur in der
 Garnison bzw. während eines
Garnison bzw. während eines
 Feld-Zuges in Bataillone zusammengefasst und von einem Major kommandiert wurden (kurios waren die ab 1864 in der konföderierten Kavallerie formierten "Q-Kompanien", deren Angehörige aufgrund fehlender Pferde zwar als Kavalleristen geführt jedoch einstweilig als Infanteristen eingesetzt wurden). Bis zur offiziellen Abschaffung der Bataillons-Ebene im Jahr 1862 bildeten regulär zwei Kompanien eine Schwadron, zwei Schwadronen wiederum ein Bataillon (wobei nach 1862 auch taktische Aufteilungen zu drei Kompanien vorkamen). Orientierte sich eine Dragoner-Kompanie der US-Kavallerie gliederungs-mäßig anfänglich am britischen Vorbild, so bewegte sich die etat-mäßige Soll-Stärke bei etwa fünfundneunzig Mann: Neben dem "Captain" als Kompanie-Führer standen der "First Lieutenant" und der "Second Lieutenant" als Stellvertreter bzw. Zug-Führer. Dazu der "First Sergeant", ein "Quartermaster Sergeant", zwei "Cornetts", vier "Line Sergeants", acht "Corporals", zwei "Trumpeters", zwei "Farriers" (Sattler und Fahrer) und zweiundsiebzig "Privates". Dazu der Chirurg, der jedoch in der Regel als
Feld-Zuges in Bataillone zusammengefasst und von einem Major kommandiert wurden (kurios waren die ab 1864 in der konföderierten Kavallerie formierten "Q-Kompanien", deren Angehörige aufgrund fehlender Pferde zwar als Kavalleristen geführt jedoch einstweilig als Infanteristen eingesetzt wurden). Bis zur offiziellen Abschaffung der Bataillons-Ebene im Jahr 1862 bildeten regulär zwei Kompanien eine Schwadron, zwei Schwadronen wiederum ein Bataillon (wobei nach 1862 auch taktische Aufteilungen zu drei Kompanien vorkamen). Orientierte sich eine Dragoner-Kompanie der US-Kavallerie gliederungs-mäßig anfänglich am britischen Vorbild, so bewegte sich die etat-mäßige Soll-Stärke bei etwa fünfundneunzig Mann: Neben dem "Captain" als Kompanie-Führer standen der "First Lieutenant" und der "Second Lieutenant" als Stellvertreter bzw. Zug-Führer. Dazu der "First Sergeant", ein "Quartermaster Sergeant", zwei "Cornetts", vier "Line Sergeants", acht "Corporals", zwei "Trumpeters", zwei "Farriers" (Sattler und Fahrer) und zweiundsiebzig "Privates". Dazu der Chirurg, der jedoch in der Regel als
 Nicht-Kombattant geführt wurde. Im Fall der Zusammenlegung mehrerer Kompanien zu einer Schwadron bzw. zu einem Bataillon übernahm entweder der dienst-älteste Kompanie-Chef das Kommando oder das Regiment betraute einen
Nicht-Kombattant geführt wurde. Im Fall der Zusammenlegung mehrerer Kompanien zu einer Schwadron bzw. zu einem Bataillon übernahm entweder der dienst-älteste Kompanie-Chef das Kommando oder das Regiment betraute einen
 Stabs-Offizier ab dem Rang eines
Stabs-Offizier ab dem Rang eines
 Majors mit dem Ober-Befehl.
Majors mit dem Ober-Befehl.
In der Gegenwart bezeichnet die Eskadron bzw. Schwadron in verschiedenen Armeen eine Teil-Einheit der (vorwiegend leichten)
 Panzer-Truppe bzw. der
Panzer-Truppe bzw. der
 Marine oder der
Marine oder der
 Luftwaffe in der ungefähren Stärke eines Bataillons (siehe auch
Luftwaffe in der ungefähren Stärke eines Bataillons (siehe auch
 Geschwader).
Geschwader).
... siehe dazu übersichtlich:  Truppen-Teile Truppen-Teile
... siehe dazu ausführlich  WIKIPEDIA WIKIPEDIA
... zurück zum  Register Register
|
Taktisches Zeichen:

Zeichen einer Schwadron der
►
Kavallerie.

US-Kavallerie um 1855,
aus der Uniform-Serie:
"Cavalry and Dragoons" von
Henry Alexander Ogden
(Quelle: ► "1st Cavalry Division")

"Get 'Em Boys!"
"7th US-Cavalry" um 1867
Gemälde von
Jerry Thomas
(Quelle: ► "Fort Wallace Museum")

Helikopter-Schwadron der "US Air-Cavalry" mit Helikoptern vom Typ Bell OH-58D "Kiowa" (1st Squadron, 17th Cavalry Regiment, 82nd Combat Aviation Brigade) über Fayetteville (N.C., USA).
(Quelle: ► WIKIWAND)
|
SIG
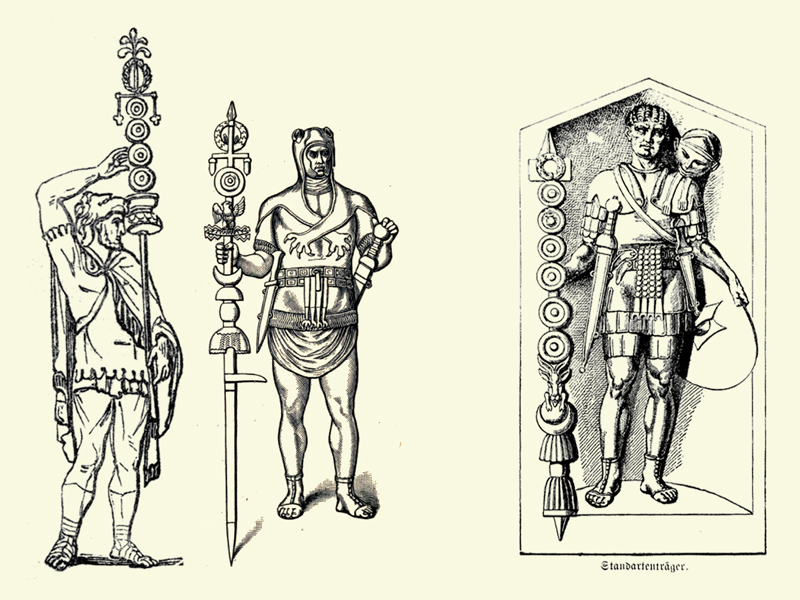
"Signifer" - Feldzeichen-Träger einer Centuria
Links: Illustration aus "The illustrated Companion to the Latin Dictionary and Greek Lexicon" von Anthony Rich (Longman, Brown u.a.; London 1849; online komplett verfügbar im Internet-Archiv ► »archive.org«).
Mitte: Illustration aus "Caesar's Gallic War" von James Bradstreet Greenough u.a. (Ginn & Company; Boston 1899; online komplett verfügbar im Internet-Archiv ► »archive.org«)
Zeichnung nach einer Grab-Platte in der Sammlung des Landesmuseums Bonn (Römer-Museum).
Rechts: Illustration aus "Leben und Sitten der Römer in der Kaiserzeit" von Julius Jung (2te Abteilung; Leipzig und Prag 1884; online komplett verfügbar in der ► »Biblioteka Narodowa« [Warschau; POL]).
Bemerkenswert hier die dargestellte Helm-Maske (Larva), die eigentlich von der Reiterei getragen wurde.
|
Signifer
Der "Signifer" (vom lat. signum: das Zeichen, und ferre; bringen, tragen; somit der Träger des [Feld-] Zeichens) war in einer
 römischen Legion der Träger des
römischen Legion der Träger des  Signums einer Signums einer  "Centuria". Die insgesamt 60 "Signiferi" einer Legion bildeten zusammen mit den "Centuria". Die insgesamt 60 "Signiferi" einer Legion bildeten zusammen mit den
 "Vexillarii" der 30
"Vexillarii" der 30  Manipel und 10 Manipel und 10
 Kohorten sowie dem
Kohorten sowie dem
 "Aquilifer" die Gruppe der
"Aquilifer" die Gruppe der
 "Signiferi", die wiederum zusammen mit rang-niederen
"Signiferi", die wiederum zusammen mit rang-niederen
 Offizieren bzw.
Offizieren bzw.
 Unteroffizieren einer Legion das Korps der rund 600
Unteroffizieren einer Legion das Korps der rund 600
 "Principales" stellten.
"Principales" stellten.
In der Regel wurde ein "Signifer" aus der Masse der erfahrenen, besonders tapferen und verdienstvollen
 Legionäre ausgewählt, wobei dessen Status (siehe dazu
Legionäre ausgewählt, wobei dessen Status (siehe dazu
 "immunis") für die als
"immunis") für die als
 Auszeichnung betrachtete Ehre keine Rolle spielte; die römische Legion honorierte besondere Verdienste im Kampf mit dem Titel "sesquiplicarius" (anderthalbfacher Sold-Empfänger) bzw. "duplicarius" oder "triplicarius" (doppelter oder dreifacher
Auszeichnung betrachtete Ehre keine Rolle spielte; die römische Legion honorierte besondere Verdienste im Kampf mit dem Titel "sesquiplicarius" (anderthalbfacher Sold-Empfänger) bzw. "duplicarius" oder "triplicarius" (doppelter oder dreifacher
 Sold).
Sold).
Obwohl der
 Feld-Zeichen-Träger rang-mäßig über den
Feld-Zeichen-Träger rang-mäßig über den
 Optio einer Zenturie gestellt war, hatte er in der Hundertschaft keine
Optio einer Zenturie gestellt war, hatte er in der Hundertschaft keine
 Kommando-Gewalt. Da der "Signifer" während eines
Kommando-Gewalt. Da der "Signifer" während eines
 Feld-Zuges bzw. im
Feld-Zuges bzw. im
 Feld-Lager aber auch die Kasse der Zenturie verwaltete, waren neben einem gewissen buchhalterischen Talent vor allem das Vertrauen der Kameraden Voraussetzung für die
Feld-Lager aber auch die Kasse der Zenturie verwaltete, waren neben einem gewissen buchhalterischen Talent vor allem das Vertrauen der Kameraden Voraussetzung für die
 Dienst-Stellung (womit der Signifer unter den einfachen Legionären erheblichen Einfluss gehabt haben dürfte).
Dienst-Stellung (womit der Signifer unter den einfachen Legionären erheblichen Einfluss gehabt haben dürfte).
Verschiedene zeitgenössische Darstellungen in musealen Sammlungen belegen, dass die Signa primär dazu dienten, die den einzelnen Zenturien verliehenen Auszeichnungen (verzierte Scheiben und medaillon-artige Plaketten mit stilisierten Symbolen, Kränzen, Girlanden etc.; siehe dazu
 "Phalerae" bzw.
"Phalerae" bzw.
 "Dona militaria") zu präsentieren. Da die Feld-Zeichen somit den gesammelten Ruhm einer einzelnen Einheit wieder-spiegelten, wurden die Stücke rituell und kultisch verehrt, in der
"Dona militaria") zu präsentieren. Da die Feld-Zeichen somit den gesammelten Ruhm einer einzelnen Einheit wieder-spiegelten, wurden die Stücke rituell und kultisch verehrt, in der
 Garnison bzw. innerhalb des
Garnison bzw. innerhalb des
 Lagers in einem altar-ähnlichen und besonders bewachten Fahnen-Heiligtum untergebracht (siehe dazu
Lagers in einem altar-ähnlichen und besonders bewachten Fahnen-Heiligtum untergebracht (siehe dazu
 "Aedes Signorum", das auch die
"Aedes Signorum", das auch die
 Truppen- bzw. Kriegs-Kasse der Legion enthielt) und in der
Truppen- bzw. Kriegs-Kasse der Legion enthielt) und in der
 Schlacht mit dem Leben verteidigt. Der Verlust des Signums galt als höchste Schande.
Schlacht mit dem Leben verteidigt. Der Verlust des Signums galt als höchste Schande.
Sekundärer Zweck des Signums bzw. Aufgabe des Signifers war es, den Legionären der Einheit aber auch dem
 Feld-Herrn den aktuellen Standort des kommandierenden
Feld-Herrn den aktuellen Standort des kommandierenden  "Centurio" anzuzeigen und dessen "Centurio" anzuzeigen und dessen
 Befehle oder die
Befehle oder die
 Signale der
Signale der
 "Aeneatores" (Cornicen, Tubicen, Bucinator) visuell zu übermitteln, wobei hier wohl bevorzugt die farblich unterschiedlichen
"Aeneatores" (Cornicen, Tubicen, Bucinator) visuell zu übermitteln, wobei hier wohl bevorzugt die farblich unterschiedlichen
 "Vexilla" Verwendung gefunden haben dürften.
"Vexilla" Verwendung gefunden haben dürften.
Somit war die Position des Signifers im Feld immer an der Seite des Zenturios.
Auffälligstes
 uniformes Merkmal der "Signiferi" waren Felle von Raub-Tieren, deren präparierte Köpfe augenscheinlich auf den Helmen (siehe dazu
uniformes Merkmal der "Signiferi" waren Felle von Raub-Tieren, deren präparierte Köpfe augenscheinlich auf den Helmen (siehe dazu
 "Cassis" bzw. dem aus Leder gefertigten
"Cassis" bzw. dem aus Leder gefertigten
 "Galea") der Träger befestigt waren; die Tatzen über die Schultern gelegt und vor der Brust kreuz-weise fixiert; wobei die Feldzeichen-Träger der Zenturien wohl bevorzugt Bären-Felle umlegten. Wie die meisten Offiziere und Unteroffiziere bevorzugten die "Signiferi" als Körper-Panzerung die
"Galea") der Träger befestigt waren; die Tatzen über die Schultern gelegt und vor der Brust kreuz-weise fixiert; wobei die Feldzeichen-Träger der Zenturien wohl bevorzugt Bären-Felle umlegten. Wie die meisten Offiziere und Unteroffiziere bevorzugten die "Signiferi" als Körper-Panzerung die
 "Lorica hamata" (das Ketten-Hemd), einzelne Darstellungen zeigen auch den aus Leder gefertigten Muskel-Panzer (siehe dazu
"Lorica hamata" (das Ketten-Hemd), einzelne Darstellungen zeigen auch den aus Leder gefertigten Muskel-Panzer (siehe dazu
 "Thorax"). Als Schild die ovale oder runde
"Thorax"). Als Schild die ovale oder runde
 "Parma" der Reiterei. Dazu die Standard-Hieb- und Stich-Waffen der Legionäre:
"Parma" der Reiterei. Dazu die Standard-Hieb- und Stich-Waffen der Legionäre:
 Gladius,
Gladius,
 Spatha und
Spatha und
 Pugio.
Pugio.
Aus den "Signiferi" der Legion gingen die
 Fähnlein- und
Fähnlein- und
 Banner-Träger der früh-mittelalterlichen
Banner-Träger der früh-mittelalterlichen
 Heere und die spätere
Heere und die spätere
 Dienstgrad- bzw. Laufbahn-Gruppe der noch heute in allen modernen
Dienstgrad- bzw. Laufbahn-Gruppe der noch heute in allen modernen  Armeen gegebenen Armeen gegebenen
 Fähnriche hervor.
Fähnriche hervor.
... siehe dazu ausführlich  WIKIPEDIA WIKIPEDIA
... zurück zum  Register Register
|


Oben: Adlocutio: Ansprache des Kaisers Mark Aurel an die Legionen zu Beginn des Daker-Feldzuges im März des Jahres 101.
Unten: Ein Aquilifer und zwei Signiferi als Versinnbildlichung einer Legion führen Kaiser Mark Aurel und seinem Sohn Commodus einen gefangenen germanischen Stammes-Fürsten vor (evt. Ariogaesus).
Ausschnitt(e) aus den "Aurelianischen Relief-Tafeln" mit Motiven der Markomannen-Kriege im Konstantin-Bogen.
Quelle: ► Wikipedia.
|
SIG
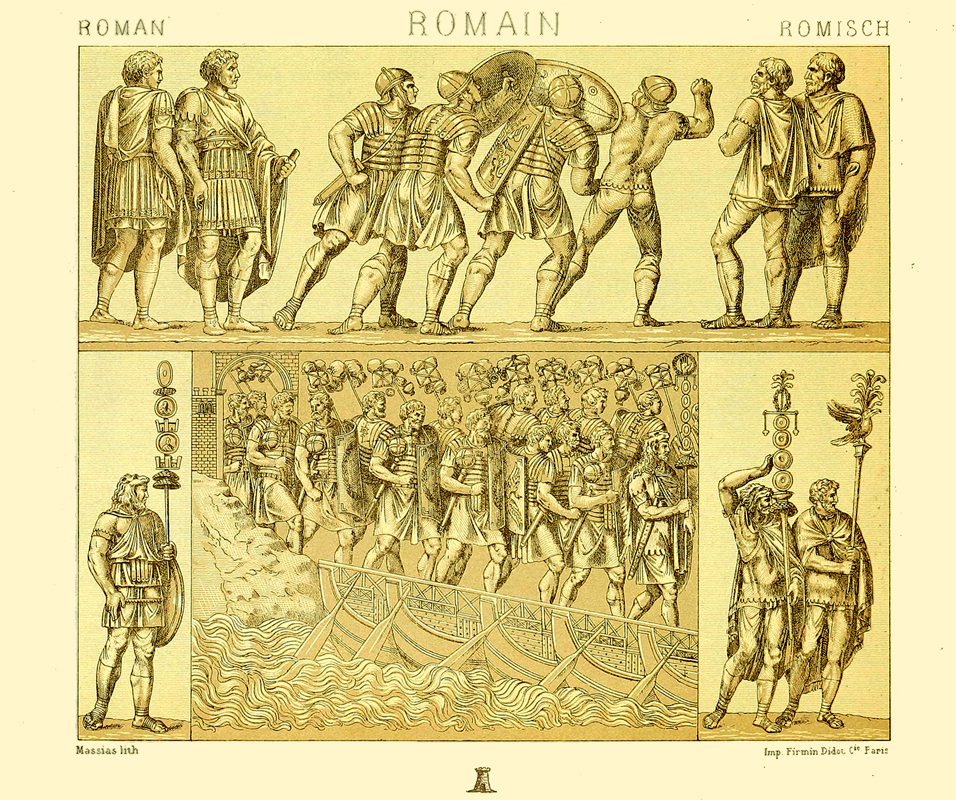
"Le Soldat Légionnaire" (Der Legions-Soldat)
Nr. 1 und 2. Feldherr und Offizier - Nr. 3, 4, 5, 6. Kämpfende Soldaten - Nr. 7 und 8. Soldaten im Lager - Nr. 9, 11 und 12. Feldzeichen-Träger - Nr. 10. Legionäre auf dem Marsch, eine Ponton-Brücke passierend.
Lithografie von Albert Racinet nach Motiven der Trajans-Säule aus Band II des 6-teiligen Tafel-Werks "Le Costume historique" (Verlegt von Firmin Didot et Cie., Paris 1876-1888; Quelle: ► eigene Sammlung)

"A Romanized Gaul - Soldat gallo-romain" (Ein gallo-römischer Aquilifer)
Illustration aus "Pictorial history of France and Normandy - From the earliest period to the present time" von W.C. (William Cooke) Taylor, 1800-1849 (Thomas, Cowperthwait & Co.; Philadelphia 1848; online komplett verfügbar im Internet-Archiv ► »archive.org«)
|
Signiferi
Als "Signiferi" (vom lat. signum: das Zeichen, und ferre; bringen, tragen; somit der Träger des [Feld-] Zeichens; Singular: Signifer) wurden in den
 Legionen des Stadt-Staates von
Legionen des Stadt-Staates von
 Rom bzw. des daraus hervor-gegangenen Imperiums zusammenfassend sämtliche
Rom bzw. des daraus hervor-gegangenen Imperiums zusammenfassend sämtliche
 Legionäre bezeichnet, die die verschiedenen Feld-Zeichen (siehe dazu
Legionäre bezeichnet, die die verschiedenen Feld-Zeichen (siehe dazu  "Signae") der einzelnen "Signae") der einzelnen  Einheiten des Einheiten des  Groß-Verbandes trugen. Groß-Verbandes trugen.
Zu ihnen gehörten:
Auch die Feldzeichen-Träger der Hilfs-Truppen (siehe dazu  "Auxilia" bzw. der "Auxilia" bzw. der
 "Numeri") und der römischen Reiterei (siehe dazu
"Numeri") und der römischen Reiterei (siehe dazu
 "Equites"), die überwiegend
"Equites"), die überwiegend
 Standarten bzw. ein
Standarten bzw. ein
 "Labarum" mit einem "Emblem" oder einer "Inscriptio" der Einheit zeigten, gehörten zur
"Labarum" mit einem "Emblem" oder einer "Inscriptio" der Einheit zeigten, gehörten zur
 Dienst-Gruppe der "Signiferi".
Dienst-Gruppe der "Signiferi".
In der Regel wurde ein "Signifer" aus der Masse der erfahrenen, besonders verdienstvollen, tapferen und mutigen Legionären ausgewählt. Die Ernennung zum Feldzeichen-Träger und die
 Dienst-Stellung wurde als Ehre und
Dienst-Stellung wurde als Ehre und
 Auszeichnung gesehen, wobei der Status des jeweiligen Soldaten (siehe dazu
Auszeichnung gesehen, wobei der Status des jeweiligen Soldaten (siehe dazu
 "immunis") keine Rolle spielte; die römische Legion honorierte besondere Verdienste mit dem Titel "sesquiplicarius" (anderthalbfacher Sold-Empfänger) bzw. "duplicarius" oder "triplicarius" (doppelter oder dreifacher
"immunis") keine Rolle spielte; die römische Legion honorierte besondere Verdienste mit dem Titel "sesquiplicarius" (anderthalbfacher Sold-Empfänger) bzw. "duplicarius" oder "triplicarius" (doppelter oder dreifacher
 Sold). Und obwohl ein Signifer innerhalb seiner Einheit kein
Sold). Und obwohl ein Signifer innerhalb seiner Einheit kein
 Kommando führte, stand er rang-mäßig über dem
Kommando führte, stand er rang-mäßig über dem
 "Optio" einer Zenturie und rangierte damit zwischen den rund 600
"Optio" einer Zenturie und rangierte damit zwischen den rund 600
 rang-niederen
rang-niederen
 Offizieren und den
Offizieren und den
 Unteroffizieren einer Legion, die zusammen das Korps der
Unteroffizieren einer Legion, die zusammen das Korps der
 "Principales" bildeten.
"Principales" bildeten.
Auffälligstes
 uniformes Merkmal sämtlicher "Signiferi" waren Felle von Raub-Tieren, deren präparierte Köpfe augenscheinlich auf den Helmen (siehe dazu
uniformes Merkmal sämtlicher "Signiferi" waren Felle von Raub-Tieren, deren präparierte Köpfe augenscheinlich auf den Helmen (siehe dazu
 "Cassis" bzw. dem aus Leder gefertigten
"Cassis" bzw. dem aus Leder gefertigten
 "Galea") der Träger befestigt waren; die Tatzen über die Schultern gelegt und vor der Brust kreuz-weise fixiert. Und obwohl zahlreiche Darstellungen auf Grab-Steinen oder Reliefs zeigen, dass es offensichtlich keine uniformen Reglementierungen bzgl. der zu verwendenden Fell-Arten gab, scheint der "Aquilifer" bevorzugt ein Löwen-, Panter- oder Tiger-Fell -, der "Vexillarius" einen Wolfs-Pelz und der "Signifer" einen Bären-Pelz getragen zu haben. Neben der martialischen Wirkung der gefletschten Zähne und der Krallen ist es naheliegend, dass die mit dem jeweiligen Tier verbundenen mystischen und natürlichen Kräfte und Stärken des Tieres in Anbetracht des herrschenden Aberglaubens auf den Träger übergehen sollten.
"Galea") der Träger befestigt waren; die Tatzen über die Schultern gelegt und vor der Brust kreuz-weise fixiert. Und obwohl zahlreiche Darstellungen auf Grab-Steinen oder Reliefs zeigen, dass es offensichtlich keine uniformen Reglementierungen bzgl. der zu verwendenden Fell-Arten gab, scheint der "Aquilifer" bevorzugt ein Löwen-, Panter- oder Tiger-Fell -, der "Vexillarius" einen Wolfs-Pelz und der "Signifer" einen Bären-Pelz getragen zu haben. Neben der martialischen Wirkung der gefletschten Zähne und der Krallen ist es naheliegend, dass die mit dem jeweiligen Tier verbundenen mystischen und natürlichen Kräfte und Stärken des Tieres in Anbetracht des herrschenden Aberglaubens auf den Träger übergehen sollten.
Da die Feld-Zeichen auch die verschiedenen Auszeichnungen präsentierten, die einer Einheit kollektiv verliehen worden waren, wurden sie in der römischen  Armee geradezu religiös-kultisch verehrt; die Träger standen damit personifiziert für den in den Armee geradezu religiös-kultisch verehrt; die Träger standen damit personifiziert für den in den
 Kriegen und
Kriegen und
 Schlachten erkämpften Ruhm, was wiederum begründet, dass die Stücke "bis zum letzten Mann" verteidigt -, in der
Schlachten erkämpften Ruhm, was wiederum begründet, dass die Stücke "bis zum letzten Mann" verteidigt -, in der
 Garnison oder im
Garnison oder im
 Feld-Lager in einem altar-ähnlichen und besonders bewachten Fahnen-Heiligtum untergebracht waren (siehe dazu
Feld-Lager in einem altar-ähnlichen und besonders bewachten Fahnen-Heiligtum untergebracht waren (siehe dazu
 "Aedes Signorum").
"Aedes Signorum").
Sekundäre Aufgabe der "Signiferi" war es, den Legionären der Einheit aber auch dem
 Feld-Herrn den aktuellen Standort des kommandierenden
Feld-Herrn den aktuellen Standort des kommandierenden  "Centurio" anzuzeigen und dessen "Centurio" anzuzeigen und dessen
 Befehle oder die
Befehle oder die
 Signale der
Signale der
 "Aeneatores" (Cornicen, Tubicen, Bucinator) visuell zu übermitteln, wobei hier wohl bevorzugt die farblich unterschiedlichen "Vexilla" Verwendung gefunden haben dürften.
"Aeneatores" (Cornicen, Tubicen, Bucinator) visuell zu übermitteln, wobei hier wohl bevorzugt die farblich unterschiedlichen "Vexilla" Verwendung gefunden haben dürften.
Somit war die Position des Signifers im Feld immer an der Seite des Zenturios.
Aus den "Signiferi" der Legion gingen die
 Fähnlein- und
Fähnlein- und
 Banner-Träger der früh-mittelalterlichen
Banner-Träger der früh-mittelalterlichen
 Heere und die spätere
Heere und die spätere
 Dienstgrad- bzw. Laufbahn-Gruppe der noch heute in allen modernen
Dienstgrad- bzw. Laufbahn-Gruppe der noch heute in allen modernen  Armeen gegebenen Armeen gegebenen
 Fähnriche hervor.
Fähnriche hervor.
... zurück zum  Register Register
|

Kaiser Trajan trifft (mit den Signiferi) im Feld-Lager ein und empfängt eine Gesandtschaft der Daker (siehe dazu ► Wikipedia).
Tafel 36 nach den Reliefs der Trajans-Säule aus "Colonna Traiana Eretta Dal Senato E Popolo Romano All'Imperatore Traiano Augusto Nel Suo Foro In Roma" von Pietro Santi Bartoli in der Sammlung der ► »Royal Academy of Arts« [London, GBR]).

"Signiferi"
Illustration aus "Veterum Romanorum - Religio, castrametatio, disciplina militaris…" (Die alten Römer - Religion, Lager-Leben, militärische Disziplin) von Guillaume du Choul (Jansson-Waesberg; Amsterdam 1686; online komplett verfügbar im Internet-Archiv ► »archive.org«).
|
SIG

"Roman Eagles and Ensigns."
Illustration aus "The Last Days of Jerusalem" von Alfred J. Church (Seeley, Jackson & Halliday, London 1883; online komplett verfügbar bei ► »GoogleBooks«)
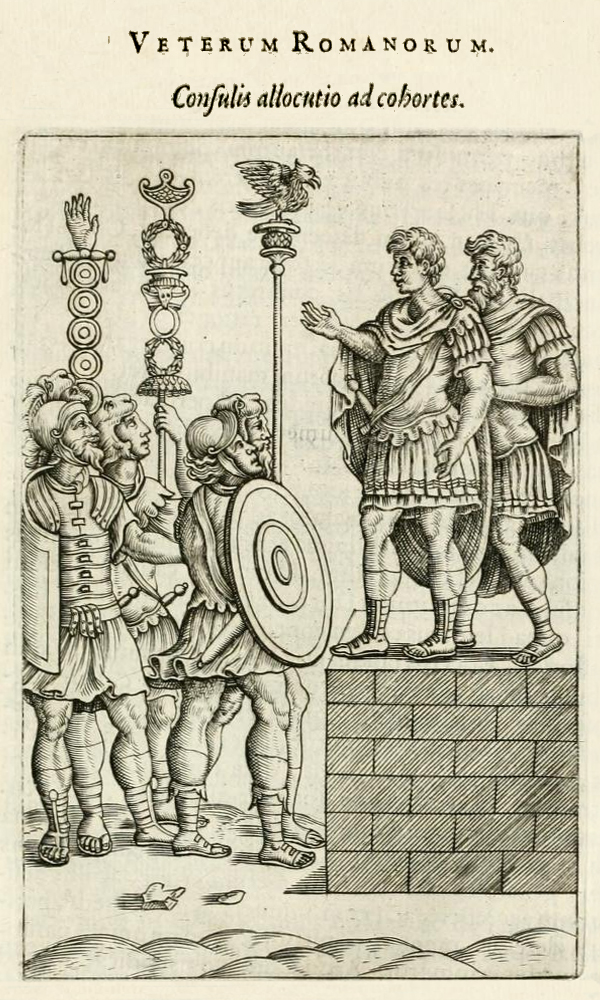
"Consulis allocutio ad cohortes" (Ansprache des Consuls an die [Signiferi der] Kohorten)
Illustration aus "Veterum Romanorum - Religio, castrametatio, disciplina militaris…" (Die alten Römer - Religion, Lager-Leben, militärische Disziplin) von Guillaume du Choul (Jansson-Waesberg; Amsterdam 1686; online komplett verfügbar im Internet-Archiv ► »archive.org«).
|
Signum
Als "Signa" (lat.: die Zeichen; Singular "Signum") wurden zusammenfassend sämtliche
 Feld-Zeichen römischer
Feld-Zeichen römischer  Truppen-Einheiten bezeichnet, die in Form von Truppen-Einheiten bezeichnet, die in Form von
 Standarten (siehe dazu
Standarten (siehe dazu
 "Vexillum" bzw.
"Vexillum" bzw.
 "Labarum"), Symbolen oder Statuetten an und/oder auf hölzernen
"Labarum"), Symbolen oder Statuetten an und/oder auf hölzernen
 Schäften von den
Schäften von den  "Signiferi" als richtungs-weisende Orientierungs-Hilfen in der "Signiferi" als richtungs-weisende Orientierungs-Hilfen in der
 Marsch- oder
Marsch- oder  Schlacht-Ordnung voran-getragen bzw. im Rahmen von Schlacht-Ordnung voran-getragen bzw. im Rahmen von
 Triumph-Zügen, bei
Triumph-Zügen, bei
 Apellen,
Apellen,
 Inspektionen oder sonstigen offiziellen Anlässen präsentiert wurden. Zahlreiche erhaltene Reliefs und Grab-Steine mit Abbildungen der Träger lassen erkennen, dass die Schäfte der "Signa") mit diversen Kränzen, Plaketten und Medaillons, Girlanden, Symbolen und Piktogrammen verziert waren, die sehr wahrscheinlich
Inspektionen oder sonstigen offiziellen Anlässen präsentiert wurden. Zahlreiche erhaltene Reliefs und Grab-Steine mit Abbildungen der Träger lassen erkennen, dass die Schäfte der "Signa") mit diversen Kränzen, Plaketten und Medaillons, Girlanden, Symbolen und Piktogrammen verziert waren, die sehr wahrscheinlich
 Auszeichnungen (siehe dazu
Auszeichnungen (siehe dazu
 "Phalerae" bzw.
"Phalerae" bzw.
 "Dona militaria") darstellen, die der Einheit für besonderen militärische Verdienste kollektiv verliehen worden waren.
"Dona militaria") darstellen, die der Einheit für besonderen militärische Verdienste kollektiv verliehen worden waren.
Bereits in den Zeiten der römischen Könige und der frühen Republik führten die von den Bürgern des Stadt-Staates von
 Rom formierten Hundertschaften Feld-Zeichen mit stilisierten Abbildern von Tieren, die mit mystischen Kräften oder einer Gottheit in Verbindung gebracht wurden (Wolf, Minotaurus oder Stier, Pferd und Eber). Diese Tradition wurde in der späten Republik bzw. im Übergang vom
Rom formierten Hundertschaften Feld-Zeichen mit stilisierten Abbildern von Tieren, die mit mystischen Kräften oder einer Gottheit in Verbindung gebracht wurden (Wolf, Minotaurus oder Stier, Pferd und Eber). Diese Tradition wurde in der späten Republik bzw. im Übergang vom
 Miliz-Heer zur
Miliz-Heer zur  Berufs-Armeen von den hier aufgestellten Berufs-Armeen von den hier aufgestellten
 Legionen übernommen, wobei gegen Ende des 2. Jahrhunderts v.u.Z. der
Legionen übernommen, wobei gegen Ende des 2. Jahrhunderts v.u.Z. der  Adler als Symbol des obersten Gottes Jupiter zum göttlichen Schutz-Heiligtum und Adler als Symbol des obersten Gottes Jupiter zum göttlichen Schutz-Heiligtum und
 Wappen-Tier des Stadt-Staates von Rom aufstieg. Im
Wappen-Tier des Stadt-Staates von Rom aufstieg. Im
 "Stehenden Heer" der
"Stehenden Heer" der
 Kaiser-Zeit verfügte jede der zehn
Kaiser-Zeit verfügte jede der zehn  Kohorten -, jede der dreißig Kohorten -, jede der dreißig  Manipel bzw. der sechzig Manipel bzw. der sechzig  Zenturien einer römischen Legion sowie sämtliche Einheiten der von den Verbündeten gestellten Zenturien einer römischen Legion sowie sämtliche Einheiten der von den Verbündeten gestellten  "Auxilia" bzw. der "Auxilia" bzw. der
 "Numeri" und die
"Numeri" und die  "Alae" der Reiterei über ein eigenes Feld-Zeichen. "Alae" der Reiterei über ein eigenes Feld-Zeichen.
Höchsten Wert hatte zweifellos der einer Legion von "Senat und Volk von Rom" (siehe dazu
 SPQR) bzw. vom Kaiser verliehene Adler (siehe dazu
SPQR) bzw. vom Kaiser verliehene Adler (siehe dazu  "Aquila"), der in verschiedensten Varianten und Haltungen offenbar als Unikat gefertigt und religiös-kultisch verehrt wurde. Sein Verlust galt als größte Schande für den gesamten "Aquila"), der in verschiedensten Varianten und Haltungen offenbar als Unikat gefertigt und religiös-kultisch verehrt wurde. Sein Verlust galt als größte Schande für den gesamten  Truppen-Verband, was begründet, dass der Adler-Träger (siehe dazu Truppen-Verband, was begründet, dass der Adler-Träger (siehe dazu  "Aquilifer") von einer eigenen "Aquilifer") von einer eigenen
 Wache gedeckt wurde (siehe dazu
Wache gedeckt wurde (siehe dazu
 "Antesignani" oder auch
"Antesignani" oder auch
 "Exubatio ad signa"). Ihm zur Seite stand ab der Kaiser-Zeit der
"Exubatio ad signa"). Ihm zur Seite stand ab der Kaiser-Zeit der
 "Imaginifer", der das
"Imaginifer", der das
 "Imago" – in der Regel ein wahrscheinlich goldenes oder zumindest vergoldetes plastisches Porträt des herrschenden Kaisers – zeigte.
"Imago" – in der Regel ein wahrscheinlich goldenes oder zumindest vergoldetes plastisches Porträt des herrschenden Kaisers – zeigte.
Umstritten ist der Status des
 "Vexillarius", der das "Vexillum" führte. Dieses Feld-Zeichen – ein farbiges, fransen-besetztes "Labarum" oder ein einfacher
"Vexillarius", der das "Vexillum" führte. Dieses Feld-Zeichen – ein farbiges, fransen-besetztes "Labarum" oder ein einfacher
 Wimpel aus Stoff mit einem
Wimpel aus Stoff mit einem
 "Emblem" der Einheit, einer "Inscriptio" und/oder einer Ziffer – wurde gleichsam von der römischen Reiterei (siehe dazu
"Emblem" der Einheit, einer "Inscriptio" und/oder einer Ziffer – wurde gleichsam von der römischen Reiterei (siehe dazu
 "Equites"), den Kohorten der Legionen als auch von deren Manipeln oder von Teil-Einheiten einer Zenturie sowie von Schiffen der römischen Kriegs-Flotte verwendet.
"Equites"), den Kohorten der Legionen als auch von deren Manipeln oder von Teil-Einheiten einer Zenturie sowie von Schiffen der römischen Kriegs-Flotte verwendet.
Die von den eigentlichen "Signiferi" der Kohorten getragenen "Signa" waren häufig mit einem Kranz umfasste Lanzen-Spitzen, oft in Form eines Lorbeer-Blattes; darunter vielfach eine rechteckige Tafel oder ein Wimpel mit der Bezeichnung der Einheit. Etwa ab der Kaiser-Zeit wird häufig auch eine erhobene Hand ("Manus") gezeigt, die als Schwur-Hand gedeutet wurde und dementsprechend die
 Legionäre an den von ihnen geleisteten
Legionäre an den von ihnen geleisteten
 Eid erinnern sollte. Diese These findet ihre Begründung in der sog. "Manus-Ehe": Das römische Bürger-Recht anerkannte eine Ehe, die im Beisein von Zeugen erklärt und mittels eines einfachen, beiderseits verkündeten Schwurs geschlossen wurde, als rechts-gültig (diese "Manus-Ehe" gingen die männlichen römischen Bürger mit ihrem Eid auch bei Dienst-Antritt mit der Legion ein). Eine weitere Erklärung findet sich in der mahnenden und gleichsam abwehrenden oder auch abweisenden Geste der erhobenen Hand, die den Zweck gehabt haben könnte, potentiellen Feinden ein deutliches Achtungs-Signal zu vermitteln (i. S. v.: "… bis hierher und nicht weiter!"). Hingegen bekundet eine erhobene Hand – der römische Gruß – noch heute eine Begrüßung bzw. den Willen zum Frieden und könnte damit als symbolisches Zeichen auch für den
Eid erinnern sollte. Diese These findet ihre Begründung in der sog. "Manus-Ehe": Das römische Bürger-Recht anerkannte eine Ehe, die im Beisein von Zeugen erklärt und mittels eines einfachen, beiderseits verkündeten Schwurs geschlossen wurde, als rechts-gültig (diese "Manus-Ehe" gingen die männlichen römischen Bürger mit ihrem Eid auch bei Dienst-Antritt mit der Legion ein). Eine weitere Erklärung findet sich in der mahnenden und gleichsam abwehrenden oder auch abweisenden Geste der erhobenen Hand, die den Zweck gehabt haben könnte, potentiellen Feinden ein deutliches Achtungs-Signal zu vermitteln (i. S. v.: "… bis hierher und nicht weiter!"). Hingegen bekundet eine erhobene Hand – der römische Gruß – noch heute eine Begrüßung bzw. den Willen zum Frieden und könnte damit als symbolisches Zeichen auch für den
 "Pax Romana" (lat.: Römischer Frieden) stehen, der nach den zwischen 133 und 30 v.u.Z. geführten Römischen Bürger-Kriegen für inneren Frieden durch Eintracht, äußere Sicherheit durch Vormacht, wirtschaftlichen Aufschwung durch Handel, bürgerliche Rechte durch Gesetze und politische Stabilität durch Wohlstand als Staats-Doktrin ausgerufen wurde.
"Pax Romana" (lat.: Römischer Frieden) stehen, der nach den zwischen 133 und 30 v.u.Z. geführten Römischen Bürger-Kriegen für inneren Frieden durch Eintracht, äußere Sicherheit durch Vormacht, wirtschaftlichen Aufschwung durch Handel, bürgerliche Rechte durch Gesetze und politische Stabilität durch Wohlstand als Staats-Doktrin ausgerufen wurde.
Als verlängerter Arm des
 Kommandeurs dienten sämtliche "Signa" als Orientierungs-Zeichen und damit im Feld dazu, den Legionären aber auch dem
Kommandeurs dienten sämtliche "Signa" als Orientierungs-Zeichen und damit im Feld dazu, den Legionären aber auch dem
 Feld-Herrn die Standorte der einzelnen "Centuriones" anzuzeigen bzw. deren
Feld-Herrn die Standorte der einzelnen "Centuriones" anzuzeigen bzw. deren
 Befehle oder die
Befehle oder die
 Signale der
Signale der
 "Aeneatores" (Cornicen, Tubicen, Bucinator) visuell zu übermitteln, wobei hier wohl bevorzugt die farblich unterschiedlichen "Vexilla" Verwendung gefunden haben dürften. Somit war die Position des Signifers bzw. des Signums im Feld immer an der Seite des Zenturios.
"Aeneatores" (Cornicen, Tubicen, Bucinator) visuell zu übermitteln, wobei hier wohl bevorzugt die farblich unterschiedlichen "Vexilla" Verwendung gefunden haben dürften. Somit war die Position des Signifers bzw. des Signums im Feld immer an der Seite des Zenturios.
Da die Feld-Zeichen den gesammelten Ruhm einer einzelnen Einheit wieder-spiegelten, wurden die Stücke rituell und kultisch verehrt, in der
 Garnison bzw. innerhalb des
Garnison bzw. innerhalb des
 Feld-Lagers in einem altar-ähnlichen und besonders bewachten Fahnen-Heiligtum untergebracht (siehe dazu
Feld-Lagers in einem altar-ähnlichen und besonders bewachten Fahnen-Heiligtum untergebracht (siehe dazu
 "Aedes Signorum", das auch die
"Aedes Signorum", das auch die
 Kasse der Legion enthielt). Aus den "Signa" der Legion gingen die
Kasse der Legion enthielt). Aus den "Signa" der Legion gingen die
 Banner,
Banner,
 Fahnen und Standarten der früh-mittelalterlichen
Fahnen und Standarten der früh-mittelalterlichen
 Heere und die noch heute in allen Armeen gegebenen Truppen-Fahnen hervor.
Heere und die noch heute in allen Armeen gegebenen Truppen-Fahnen hervor.
... siehe dazu ausführlich  WIKIPEDIA WIKIPEDIA
... zurück zum  Register Register
|
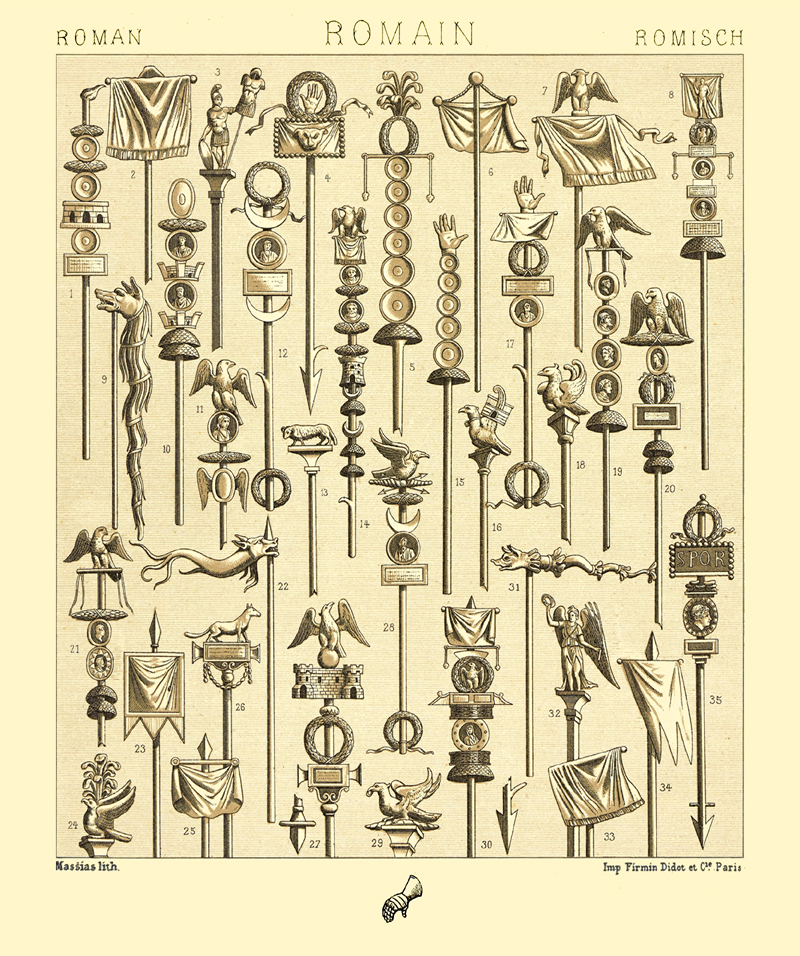
"Enseignes militaires" (Römische Feld-Zeichen)
Lithografie von Albert Racinet aus Band II des 6-teiligen Tafel-Werks "Le Costume historique" (Verlegt von Firmin Didot et Cie., Paris 1876-1888; Quelle: ► eigene Sammlung)
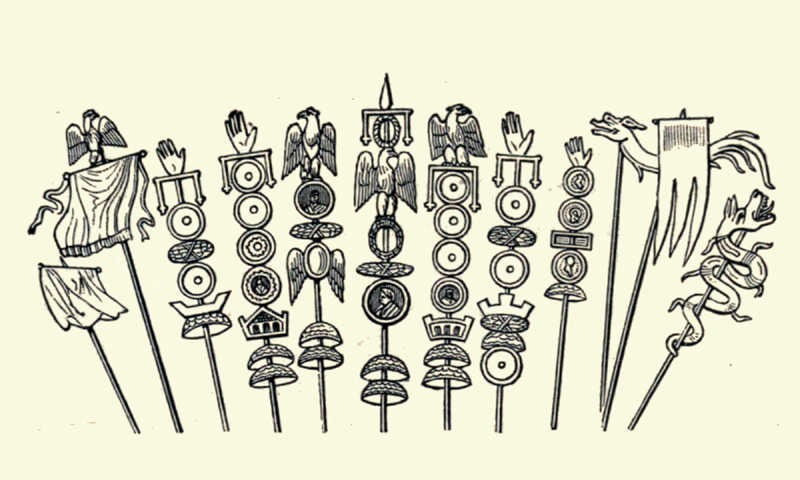
"Signa Militaria" (militärische Feld-Zeichen)
Illustration aus "Caesar's Gallic War" von James Bradstreet Greenough u.a. (Ginn & Company; Boston 1899; online komplett verfügbar im Internet-Archiv ► »archive.org«)

"Standard Bearers" (Feldzeichen-Träger)
Illustration aus "A First Latin Reader" von Herbert Chester Nutting (American Book Company; 1912; online komplett verfügbar im Internet-Archiv ► »archive.org«)
|
STA |
Stangen-Waffen
Stangen-Waffen bilden eine Ordnung des Komplexes der  Blank-Waffen. Blank-Waffen.
Als Stangen-Waffen kommen alle Arten von  Waffen oder waffenähnliche Gegenstände in Betracht, die objektiv die spezifischen Kriterien von Waffen oder waffenähnliche Gegenstände in Betracht, die objektiv die spezifischen Kriterien von  Schlag- und/oder Schlag- und/oder  Stoß- bzw. Stoß- bzw.  Hieb- und/oder Hieb- und/oder  Stich-Waffe aufweisen, jedoch subjektiv an einem verlängerten Schaft (Stange) befestigt sind. In der Regel sind Stangen-Waffen darauf ausgelegt, ihre optimale Wirkung auf einen Körper erst durch die beid- oder zwei-händige Führung von einer Person zu erzielen. Sekundär können Stangen-Waffen auch dazu geeignet sein, durch die stabilisierenden Eigenschaften des stab-förmigen Griff-Stückes auch auf ein Ziel mittels eines Stich-Waffe aufweisen, jedoch subjektiv an einem verlängerten Schaft (Stange) befestigt sind. In der Regel sind Stangen-Waffen darauf ausgelegt, ihre optimale Wirkung auf einen Körper erst durch die beid- oder zwei-händige Führung von einer Person zu erzielen. Sekundär können Stangen-Waffen auch dazu geeignet sein, durch die stabilisierenden Eigenschaften des stab-förmigen Griff-Stückes auch auf ein Ziel mittels eines  Wurfs gelenkt zu werden. Stangen-Waffen werden den Wurfs gelenkt zu werden. Stangen-Waffen werden den  Abstands- oder unbedingten Abstands- oder unbedingten  Distanz-Waffen zugeordnet. Distanz-Waffen zugeordnet.
Im Bestreben, einen u.U. überlegenen Gegner oder ein gefährliches Tier im Rahmen einer Jagd oder eines
 Zwei-Kampfes auf Abstand bekämpfen -, halten oder angreifen - bzw.
Zwei-Kampfes auf Abstand bekämpfen -, halten oder angreifen - bzw.  Angriffe aus einer gewissen Entfernung abwehren (siehe dazu Angriffe aus einer gewissen Entfernung abwehren (siehe dazu
 Verteidigung) oder selbst ausführen zu können, wurden Waffen bereits in der frühen Vorzeit mit hölzernen Schäften verlängert. Und obwohl sich
Verteidigung) oder selbst ausführen zu können, wurden Waffen bereits in der frühen Vorzeit mit hölzernen Schäften verlängert. Und obwohl sich
 Speer,
Speer,
 Spieß und
Spieß und
 Lanze auf den ersten Eindruck in ihrer Funktion nur wenig voneinander unterscheiden, entwickelten sich schon sehr früh diverse Unter-Ordnungen, die sich durch die taktisch-technische Verwendung voneinander abgrenzten.
Lanze auf den ersten Eindruck in ihrer Funktion nur wenig voneinander unterscheiden, entwickelten sich schon sehr früh diverse Unter-Ordnungen, die sich durch die taktisch-technische Verwendung voneinander abgrenzten.
Zur Ordnung der Stangen-Waffen gehören folgende Unter-Ordnungen:
Neben den vorgenannten Kriterien zeichneten sich Stangen-Waffen vor allem durch ihre vielfältigen Kombinationen und daraus abzuleitenden Verwendungs-Möglichkeiten aus. Neben Hieb- und Stich-Wirkungen gibt es diverse "Hybrid"-Modelle, die aufgrund der Klingen-Form als effektive Schlag- und Durchschlags-, Zug- und Stoß-Waffen eingesetzt werden können.
Bereits im
 Altertum gehörten Stangen-Waffen zur Standart-Bewaffnung
Altertum gehörten Stangen-Waffen zur Standart-Bewaffnung  antiker antiker
 Heere. So führten bspw. die
Heere. So führten bspw. die
 Krieger der griechischen
Krieger der griechischen
 Phalanx- Spieße mit einer Schaft-Länge von bis zu acht Metern (siehe dazu
Phalanx- Spieße mit einer Schaft-Länge von bis zu acht Metern (siehe dazu
 Sarissa). In der
Sarissa). In der
 römischen Legion kamen Stangen-Waffen hauptsächlich als Wurf-Waffe (siehe
römischen Legion kamen Stangen-Waffen hauptsächlich als Wurf-Waffe (siehe
 Hasta oder
Hasta oder
 Pilum) zum Einsatz. Im frühen
Pilum) zum Einsatz. Im frühen  Mittelalter entwickelten sich wimpel- und banner-verzierte Stangen-Waffen neben Mittelalter entwickelten sich wimpel- und banner-verzierte Stangen-Waffen neben
 Schwert und
Schwert und
 Streit-Kolben zur Haupt-Waffe der
Streit-Kolben zur Haupt-Waffe der
 Ritter. Die breite Masse der Knechte und
Ritter. Die breite Masse der Knechte und
 Söldner in den mittelalterlichen
Söldner in den mittelalterlichen
 Schlacht-Haufen führten als bevorzugte Bewaffnung zu großen Teilen sogenannte "Bauern-Waffen", die ursprünglich in der Land-Wirtschaft Verwendung fanden, durch technische Modifikationen anfänglich als improvisierte Kampf-Werkzeuge abgewertet oder auch als gefährliche Werkzeuge tituliert -, bald jedoch zu vollwertigen Kampf-Waffen umfunktioniert wurden. Und obwohl Stangen-Waffen mit dem Aufkommen der
Schlacht-Haufen führten als bevorzugte Bewaffnung zu großen Teilen sogenannte "Bauern-Waffen", die ursprünglich in der Land-Wirtschaft Verwendung fanden, durch technische Modifikationen anfänglich als improvisierte Kampf-Werkzeuge abgewertet oder auch als gefährliche Werkzeuge tituliert -, bald jedoch zu vollwertigen Kampf-Waffen umfunktioniert wurden. Und obwohl Stangen-Waffen mit dem Aufkommen der
 Feuer-Waffen bzw. dem
Feuer-Waffen bzw. dem
 Bajonett mehr und mehr aus den
Bajonett mehr und mehr aus den
 "Stehenden Heeren" der frühen
"Stehenden Heeren" der frühen  Neuzeit verdrängt wurden, blieben Hellebarde, Neuzeit verdrängt wurden, blieben Hellebarde,
 Partisane und
Partisane und
 Sponton noch geraume Zeit Status-Symbol von Leib- oder Haus-Garden (siehe dazu
Sponton noch geraume Zeit Status-Symbol von Leib- oder Haus-Garden (siehe dazu
 Garde),
Garde),
 Offizieren und
Offizieren und
 Unteroffizieren (aber auch von sogenannten Nacht-Wächtern). Dem entgegen erfuhr die metallene Rohr-Lanze zwischen dem 19. und frühen 20. Jahrhundert eine zweifelhafte Aufwertung durch die europaweite Wiederbelebung der
Unteroffizieren (aber auch von sogenannten Nacht-Wächtern). Dem entgegen erfuhr die metallene Rohr-Lanze zwischen dem 19. und frühen 20. Jahrhundert eine zweifelhafte Aufwertung durch die europaweite Wiederbelebung der
 Lanzen-Reiter bzw. der
Lanzen-Reiter bzw. der
 Ulanen. Im Rahmen von bewaffneten Erhebungen dienten Stangen-Waffen zur improvisierten Not-Bewaffnung von Aufständischen. Noch heute werden Stangen-Waffen bei zeremoniellen Anlässen präsentiert. So führen bspw. die Angehörigen der
Ulanen. Im Rahmen von bewaffneten Erhebungen dienten Stangen-Waffen zur improvisierten Not-Bewaffnung von Aufständischen. Noch heute werden Stangen-Waffen bei zeremoniellen Anlässen präsentiert. So führen bspw. die Angehörigen der
 "Schweizer Garde" des Vatikans Hellebarden als Interims-Waffen.
"Schweizer Garde" des Vatikans Hellebarden als Interims-Waffen.
... mehr zum Thema:  KATEGORISIERUNG der Waffen KATEGORISIERUNG der Waffen
... siehe dazu ausführlich  WIKIPEDIA WIKIPEDIA
... zurück zum  Register Register
|
|
STI |
Stich-Waffen
Stich-Waffen bilden eine Ordnung des Komplexes der  Blank-Waffen. Blank-Waffen.
Als Stich-Waffen kommen alle Arten von  Waffen oder waffenähnliche Gegenstände in Betracht, die nach ihrer Konstruktion dazu bestimmt bzw. als gespitzte Objekte dazu geeignet sind, in einen Körper mittels der von einer Person bei einer Stoß-Bewegung aufgewendeten Kraft spezifisch einzudringen. Direkte oder indirekte Folge des Gebrauchs einer Stich-Waffe sind Penetrationen (Durchdringungen) bzw. Perforationen (Durchlöcherungen). Kurzschäftige Stich-Waffen gehören in den Bereich der Waffen oder waffenähnliche Gegenstände in Betracht, die nach ihrer Konstruktion dazu bestimmt bzw. als gespitzte Objekte dazu geeignet sind, in einen Körper mittels der von einer Person bei einer Stoß-Bewegung aufgewendeten Kraft spezifisch einzudringen. Direkte oder indirekte Folge des Gebrauchs einer Stich-Waffe sind Penetrationen (Durchdringungen) bzw. Perforationen (Durchlöcherungen). Kurzschäftige Stich-Waffen gehören in den Bereich der  Kontakt-Waffen, langschäftige Stich-Waffen werden den Kontakt-Waffen, langschäftige Stich-Waffen werden den  Abstands- oder Abstands- oder  Stangen-Waffen zugeordnet. Stangen-Waffen zugeordnet.
In der Regel wird ein Stich durch eine geradlinig-schwungvolle Aushol-Bewegung des waffen-führenden Arms vorbereitet und anschließend durch eine geradlinig-kraftvolle Stoß-Bewegung ausgeführt, wobei die
 Klinge beim Auftreffen auf den gegnerischen Körper durch ihr spitz zulaufendes Ende (Ort) eine durchdringende -, unter Voraussetzung einer geschliffenen Klinge und in Verbindung mit einer anschließenden Zug-Bewegung auch eine schneidende Wirkung haben. Derartige Bewegungen werden allgemein in der "Fecht-Kunst" vermittelt.
Klinge beim Auftreffen auf den gegnerischen Körper durch ihr spitz zulaufendes Ende (Ort) eine durchdringende -, unter Voraussetzung einer geschliffenen Klinge und in Verbindung mit einer anschließenden Zug-Bewegung auch eine schneidende Wirkung haben. Derartige Bewegungen werden allgemein in der "Fecht-Kunst" vermittelt.
Klassische Stich-Waffen definieren sich somit als Gegenstände mit einer harten, geraden, spitzen oder gespitzten Breit- oder Blatt-, Rund- oder Hohl-Klinge, die fest an einem Griff-Stück (Heft) montiert ist bzw. dort fest arretiert, wobei Klinge und Griff-Stück bei optimalen Stich-Waffen auf eine mittige Linie in Stoß-Richtung ausgelegt sind. Die physischen Einwirkungen einer Stich-Waffe werden als "scharfe Gewalt" bezeichnet.
Zur Ordnung der klassischen Stich-Waffen gehören folgende Gruppen:
Da diverse Stich-Waffen auch zum  Wurf, Wurf,  Schlag oder Schlag oder  Hieb verwendet werden können, sind die Übergänge fließend. Waffen, die zugleich Stich- und Schnitt-Wirkungen haben, werden als Hieb verwendet werden können, sind die Übergänge fließend. Waffen, die zugleich Stich- und Schnitt-Wirkungen haben, werden als  Hieb- und Stich-Waffen bezeichnet. Hingegen werden Waffen, die mit einer Stich-Bewegung zum Einsatz gebracht werden, jedoch nicht über ein spitz zulaufendes Ende verfügen, Hieb- und Stich-Waffen bezeichnet. Hingegen werden Waffen, die mit einer Stich-Bewegung zum Einsatz gebracht werden, jedoch nicht über ein spitz zulaufendes Ende verfügen,  Stoß-Waffen genannt. Stoß-Waffen genannt.
... mehr zum Thema:  KATEGORISIERUNG der Waffen KATEGORISIERUNG der Waffen
... siehe dazu ausführlich  WIKIPEDIA WIKIPEDIA
... zurück zum  Register Register
|
|
STO |
Stoß-Waffen
Stoß-Waffen bilden eine Ordnung des Komplexes der  Blank-Waffen. Blank-Waffen.
Als Stoß-Waffen kommen alle Arten von  Waffen oder waffenähnliche Gegenstände in Betracht, die nach ihrer Konstruktion dazu bestimmt bzw. als stumpfe Objekte dazu geeignet sind, auf einen Körper mittels der von einer Person bei einer Ramm-Bewegung aufgewendeten Kraft spezifisch einzuwirken. Direkte oder indirekte Folge des Gebrauchs einer Stoß-Waffe sind Prellungen oder Zertrümmerungen. Kurzschäftige Stoß-Waffen gehören in den Bereich der Waffen oder waffenähnliche Gegenstände in Betracht, die nach ihrer Konstruktion dazu bestimmt bzw. als stumpfe Objekte dazu geeignet sind, auf einen Körper mittels der von einer Person bei einer Ramm-Bewegung aufgewendeten Kraft spezifisch einzuwirken. Direkte oder indirekte Folge des Gebrauchs einer Stoß-Waffe sind Prellungen oder Zertrümmerungen. Kurzschäftige Stoß-Waffen gehören in den Bereich der  Kontakt-Waffen, langschäftige Stoß-Waffen werden den Kontakt-Waffen, langschäftige Stoß-Waffen werden den  Abstands- oder Abstands- oder  Stangen-Waffen zugeordnet. Stangen-Waffen zugeordnet.
In der Regel wird ein Stoß durch eine weitestgehend geradlinig-schwungvolle Aushol-Bewegung vorbereitet und anschließend durch eine geradlinig-kraftvolle Ramm-Bewegung ausgeführt, wobei die Stoß-Waffe entweder ein- oder zweihändig geführt werden kann. Der geübte  Angreifer wird dabei bestrebt sein, den Stoß-Kopf seiner jeweiligen Stoß-Waffe schnell und mit Wucht auf einen möglichst ungedeckten und verletzlichen Bereich des gegnerischen Körpers zu lenken. Eine besondere Stoß-Waffen-Art ist die fest am Körper angelegte Turnier-Lanze, deren Wirkung (die Impuls-Übertragung) durch die Masse und die Geschwindigkeit des galoppierenden Pferdes noch potenziert wird. Angreifer wird dabei bestrebt sein, den Stoß-Kopf seiner jeweiligen Stoß-Waffe schnell und mit Wucht auf einen möglichst ungedeckten und verletzlichen Bereich des gegnerischen Körpers zu lenken. Eine besondere Stoß-Waffen-Art ist die fest am Körper angelegte Turnier-Lanze, deren Wirkung (die Impuls-Übertragung) durch die Masse und die Geschwindigkeit des galoppierenden Pferdes noch potenziert wird.
Bei der waffentechnisch-physikalischen Betrachtung einer Stoß-Waffe ist der Umstand beachtenswert, dass je schwerer die Stoß-Waffe ist, desto größer die mit dem Stoß übertragene kinetische Energie und die dadurch verursachte Verletzung ist, wobei eine Stoß-Waffe jedoch mit zunehmendem Gewicht und ausweitender Schaft-Länge umso unhandlicher in der Handhabung wird.
Klassische Stoß-Waffen definieren sich somit als Gegenstände mit einem harten, relativ schweren, abgerundeten, stumpfen, stumpfkantigen oder breitflächigen Ramm-Kopf, der fest auf einem starren Schaft montiert ist. Die physischen Einwirkungen einer Sroß-Waffe werden als "stumpfe Gewalt" bezeichnet.
Zur Ordnung der Stoß-Waffen gehören folgende Gruppen:
Da diverse Stoß-Waffen auch zum  Schlag verwendet werden können, sind die Übergänge fließend. Hingegen werden Waffen, die zwar mit einer Stoß-Bewegung zum Einsatz gebracht werden, jedoch von mehreren Männern geführt werden, als Schlag verwendet werden können, sind die Übergänge fließend. Hingegen werden Waffen, die zwar mit einer Stoß-Bewegung zum Einsatz gebracht werden, jedoch von mehreren Männern geführt werden, als
 Rammen oder Ramm-Waffen bezeichnet.
Rammen oder Ramm-Waffen bezeichnet.
... mehr zum Thema:  KATEGORISIERUNG der Waffen KATEGORISIERUNG der Waffen
... siehe dazu ausführlich  WIKIPEDIA WIKIPEDIA
... zurück zum  Register Register
|
 Stoß-Waffen (Montage);
Turnier-Lanzen, auch "Renn-Spieße" oder "Störtzer" genannt
oben rechts: "Krönig" für die Tjost (Turnier); unbenutzt und benutzt
unten rechts: Spitze für das oft tödliche "Scharf-Rennen" |
STR |
Streitkräfte (auch Teil-Streitkräfte)
(engl.: Military forces bzw. Armed forces; franz.: Forces armées; russ.: Вооружённые силы)
Unter dem Begriff Streitkraft (auch Streitmacht, umgangssprachlich als  Armee bezeichnet) versteht man die Gesamtheit sämtlicher militärischen Kräfte, die einem nationalen Territorial-Staat bzw. einer politisch-militärischen Armee bezeichnet) versteht man die Gesamtheit sämtlicher militärischen Kräfte, die einem nationalen Territorial-Staat bzw. einer politisch-militärischen
 Allianz für
Allianz für
 strategische
strategische
 Verteidigungs- und/oder
Verteidigungs- und/oder  Angriffs-Zwecke zur Verfügung stehen bzw. die von oder im Auftrag einer souveränen Instanz zur Wahrung, Sicherung und Durchsetzung der äußeren hoheitlichen Rechte eines Staates auch unter Anwendung von Angriffs-Zwecke zur Verfügung stehen bzw. die von oder im Auftrag einer souveränen Instanz zur Wahrung, Sicherung und Durchsetzung der äußeren hoheitlichen Rechte eines Staates auch unter Anwendung von  Waffen-Gewalt errichtet und unterhalten wurden (und werden). Waffen-Gewalt errichtet und unterhalten wurden (und werden).
In der Regel untersteht die Streitmacht eines Landes dem Befehl einer staatlich-parlamentarischen -, in vielen Teilen der Welt auch monarchistischen bzw. diktatorischen Autorität, wobei die administrative Gewalt in der Regel einem
 Kriegsrat (bzw. einem Kriegs- oder Verteidigungs-Ministerium) übergeben wurde, der wiederum als exekutive Gewalt einen obersten
Kriegsrat (bzw. einem Kriegs- oder Verteidigungs-Ministerium) übergeben wurde, der wiederum als exekutive Gewalt einen obersten
 General-Stab (o.ä.) mit dem Ober-Kommando über sämtliche
General-Stab (o.ä.) mit dem Ober-Kommando über sämtliche  Verbände und Verbände und  Truppen-Teile dieser Streitmacht betraut hat. Aus organisatorischen, logistischen und taktisch-operativen Gründen unterteilt sich eine militärische Streitmacht in einzelne Teil-Streitkräfte, die wiederum eigene Führungs-Stäbe haben, die jedoch dem Ober-Kommando unterstehen. Truppen-Teile dieser Streitmacht betraut hat. Aus organisatorischen, logistischen und taktisch-operativen Gründen unterteilt sich eine militärische Streitmacht in einzelne Teil-Streitkräfte, die wiederum eigene Führungs-Stäbe haben, die jedoch dem Ober-Kommando unterstehen.
Nach der klassischen Militär-Philosophie operieren die Teil-Streitkräfte in elementaren Räumen.
Zu den klassischen Teil-Streitkräften gehören:
Zu den modernen Teil-Streitkräften gehören:
In der Entwicklung bzw. im annehmbaren Aufbau befinden sich folgende Teil-Streitkräfte:
- Raum-Streitkräfte oder "Outerspace-Forces" (siehe dazu
 WIKIPEDIA) WIKIPEDIA)
- "Cyberspace-Forces" (siehe dazu
 WIKIPEDIA) WIKIPEDIA)
Nach der hierarchischen Ordnung militärischer Verbände gliedern sich die Teil-Streitkräfte in verschiedene  Truppen-Gattungen, die aus den einzelnen Truppen-Gattungen, die aus den einzelnen
 Waffen-Gattungen gebildet werden.
Waffen-Gattungen gebildet werden.
Die in sämtlichen Armeen dieser Welt vorhandenen
 Reservisten, die im Fall einer
Reservisten, die im Fall einer
 Mobilmachung bestehende bzw. aktive Einheiten ergänzen oder in der Vergangenheit zur Formation s.g.
Mobilmachung bestehende bzw. aktive Einheiten ergänzen oder in der Vergangenheit zur Formation s.g.
 "Landwehr"-Verbände herangezogen wurden, gelten als besonderer Bestandteil der Streitkräfte.
"Landwehr"-Verbände herangezogen wurden, gelten als besonderer Bestandteil der Streitkräfte.
... siehe dazu übersichtlich:  Truppen-Teile Truppen-Teile
... siehe dazu ausführlich  WIKIPEDIA WIKIPEDIA
... zurück zum  Register Register
|
|
STU
 Schweres Geschütz
Holzschnitt von Hans Burgkmair (1473-1531)
Illustration aus »Der Krieg in Bildern« von Alfred Steinitzer und Wilhelm Michel; Verlag: R. Piper & Co, München, 1912 (siehe dazu ► »archive.org«
(Quelle: eigene Sammlung)
|
Stück (Regiments- oder Bataillons-Stück bzw. -Geschütz)
Als "Stück" wurde in der frühen deutschen
 Artillerie (siehe dazu
Artillerie (siehe dazu  Arkeley) ein einzelnes Arkeley) ein einzelnes
 Geschütz bezeichnet, das bspw. während der
Geschütz bezeichnet, das bspw. während der
 Belagerung einer
Belagerung einer
 befestigten Stätte gleichsam zum
befestigten Stätte gleichsam zum  Angriff als auch zur Angriff als auch zur
 Verteidigung verwendet werden konnte, wobei bis zum Ende des
Verteidigung verwendet werden konnte, wobei bis zum Ende des  Mittelalters keine Unterscheidung zwischen einem mechanischen Mittelalters keine Unterscheidung zwischen einem mechanischen
 Wurf- oder einem pyrotechnischen
Wurf- oder einem pyrotechnischen
 Rohr-Geschütz gemacht wurde. Kommandiert wurde das Stück von einem
Rohr-Geschütz gemacht wurde. Kommandiert wurde das Stück von einem  Stück- bzw. Stück- bzw.
 Büchsen-Meister oder stellvertretend von einem
Büchsen-Meister oder stellvertretend von einem  Stück-Junker; als Stück-Junker; als
 Bedienung fungierten spezialisierte
Bedienung fungierten spezialisierte  Stück-Knechte, als Hilfs-Kräfte wurden sog. Stück-Knechte, als Hilfs-Kräfte wurden sog.  "Schneller" eingesetzt. Vorsteher sämtlicher Stück-Mannschaften war der aus der Runde der Stück-Meister gewählte "Schneller" eingesetzt. Vorsteher sämtlicher Stück-Mannschaften war der aus der Runde der Stück-Meister gewählte
 Geschütz-Meister.
Geschütz-Meister.
Da mittelalterliche Geschütze in der Regel "Stück für Stück" von fachkundigen Handwerker-Meistern in manueller Einzel-Produktion gefertigt wurden -; auch die Reparatur und Instandhaltung sowie die einzelnen Abläufe zur Bedienung eines Geschützes eine Vielzahl handwerklicher Künste und Tätigkeiten erforderte, bildeten die Angehörigen des sog.  "Antwerkes" ab dem 14. Jahrhundert eigene Zünfte (so nennen diverse Lexika des 19. Jahrhunderts bspw. die "Antwerkes" ab dem 14. Jahrhundert eigene Zünfte (so nennen diverse Lexika des 19. Jahrhunderts bspw. die
 "Zunft der Blydner"; auch leiten im deutsch-sprachigen Raum viele Schützen- und/oder Böller-Vereine ihre Geschichte von der Tradition früh-bürgerlicher Schützen–Gilden ab). Diese historische Entwicklung begründet die Ausnahme, dass in der bald aufkommenden
"Zunft der Blydner"; auch leiten im deutsch-sprachigen Raum viele Schützen- und/oder Böller-Vereine ihre Geschichte von der Tradition früh-bürgerlicher Schützen–Gilden ab). Diese historische Entwicklung begründet die Ausnahme, dass in der bald aufkommenden  Truppen-Gattung der Artillerie auch Angehörige der bürgerlichen Stände ein Truppen-Gattung der Artillerie auch Angehörige der bürgerlichen Stände ein
 Offiziers-Patent erhalten konnten. Und hatten die aus den Städten geworbenen, angemieteten oder gemäß bestehender Verträge zur allgemeinen
Offiziers-Patent erhalten konnten. Und hatten die aus den Städten geworbenen, angemieteten oder gemäß bestehender Verträge zur allgemeinen
 Heeresfolge verpflichteten Stück-Mannschaften samt ihren Stücken noch im
Heeresfolge verpflichteten Stück-Mannschaften samt ihren Stücken noch im  Heer als auch im Heer als auch im
 Lager der im späten 15. Jahrhundert aufkommenden
Lager der im späten 15. Jahrhundert aufkommenden
 Landsknechte eine rechtliche, organisatorische und finanzielle Sonderstellung, so änderte sich der Status der freien Meister und ihrer zunftmäßigen Kunst während des Dreißigjährigen Krieges (1618-1648; siehe dazu
Landsknechte eine rechtliche, organisatorische und finanzielle Sonderstellung, so änderte sich der Status der freien Meister und ihrer zunftmäßigen Kunst während des Dreißigjährigen Krieges (1618-1648; siehe dazu  WIKIPEDIA). WIKIPEDIA).
Unter militär-historischen Aspekten wurden leichte und damit schnell bewegliche Stücke der feuernden Artillerie effektiv und massiv erstmals zwischen 1419 und 1424 als "Begleit-Geschütz" im Heer der insbesondere für die Taktik der
 Wagen-Burgen bekannt gewordenen
Wagen-Burgen bekannt gewordenen
 Hussiten verwendet. Zur Unterstützung einer geschlossenen
Hussiten verwendet. Zur Unterstützung einer geschlossenen  Schlacht-Formation wurden leichte Feld-Geschütze erstmals im Jahr 1467 vom italienischen Schlacht-Formation wurden leichte Feld-Geschütze erstmals im Jahr 1467 vom italienischen
 Condottiere Bartolomeo Colleoni (1400-1475; siehe dazu
Condottiere Bartolomeo Colleoni (1400-1475; siehe dazu  WIKIPEDIA) gegen die Medici in Florenz eingesetzt. WIKIPEDIA) gegen die Medici in Florenz eingesetzt.
... mehr zum Thema:  KOMPENDIUM der Waffenkunde - Stück KOMPENDIUM der Waffenkunde - Stück
... siehe dazu ausführlich  WIKIPEDIA WIKIPEDIA
... zurück zum  Register Register
|
 Szene aus dem Dreißigjährigen Krieg: Einrichten eines leichten Feld-Stückes
Gemälde von Christian Sell (1831-1883)
(Quelle: ► »MutualArt Services, Inc.«)
 Szene aus dem Dreißigjährigen Krieg: Laden eines leichten Feld-Stückes
Gemälde von Christian Sell (1831-1883)
(Quelle: ► »Artist Auction Records«)
|
STU
 Stück-Knechte an der Kanone.
La préparation (Die Vorbereitung).
Abbildungen aus der 14-teiligen Serie »Les exercices militaires« (Militärische Übungen)
L'exercice du canon - Übungen an der Kanone von Jacques Callot (1592-1635)
(Quelle: ► »Bibliothèque nationale de France«)
|
Stück-Junker
Als Stück-Junker wurde in der frühen deutschen
 Artillerie (siehe dazu
Artillerie (siehe dazu  Arkeley) der von einem Arkeley) der von einem
 Büchsen- oder
Büchsen- oder  Stück-Meister ausgewählte Lehrling bezeichnet, der aufgrund familiärer Bindungen oder auch durch Zahlung eines außerordentlichen Lehr-Geldes bestrebt -, infolge seines persönlichen Engagements oder seiner wissenschaftlich-technischen Vorbildung geeignet war, im Ergebnis einer Gesellen-Prüfung ein Stück-Meister ausgewählte Lehrling bezeichnet, der aufgrund familiärer Bindungen oder auch durch Zahlung eines außerordentlichen Lehr-Geldes bestrebt -, infolge seines persönlichen Engagements oder seiner wissenschaftlich-technischen Vorbildung geeignet war, im Ergebnis einer Gesellen-Prüfung ein
 Patent zu erhalten, das es ihm ermöglichte, selbst zum Stück-Meister aufsteigen bzw. zum
Patent zu erhalten, das es ihm ermöglichte, selbst zum Stück-Meister aufsteigen bzw. zum
 Offizier "avanciren" zu können. Nach Abschluss seiner Lehre befehligte der Stück-Junker im
Offizier "avanciren" zu können. Nach Abschluss seiner Lehre befehligte der Stück-Junker im
 Rang eines
Rang eines  Konstablers (später Konstablers (später
 Korporal) mindestens ein
Korporal) mindestens ein
 "Stück" (siehe dazu auch
"Stück" (siehe dazu auch
 Geschütz). Der älteste Stück-Junker, seit 1411 in Frankreich als "Maître Cannonier" betitelt, war als Stellvertreter des Meisters für die
Geschütz). Der älteste Stück-Junker, seit 1411 in Frankreich als "Maître Cannonier" betitelt, war als Stellvertreter des Meisters für die
 Instandhaltung der Geschütze und die Lagerung der
Instandhaltung der Geschütze und die Lagerung der
 Munition verantwortlich und kommandierte die
Munition verantwortlich und kommandierte die
 Wache des
Wache des
 Zeug-Hauses oder der
Zeug-Hauses oder der
 Geschütz-Stellung, leitete die
Geschütz-Stellung, leitete die
 Ausbildung, kontrollierte
Ausbildung, kontrollierte
 Ordnung und
Ordnung und
 Disziplin und hatte auch strafrechtliche Gewalt. In der Regel trat er die Nachfolge des Stück-Meisters an.
Disziplin und hatte auch strafrechtliche Gewalt. In der Regel trat er die Nachfolge des Stück-Meisters an.
Da die
 Bedienungen der Geschütze gleich den Mannschaften der
Bedienungen der Geschütze gleich den Mannschaften der
 pionier- und ingenieur-technischen Truppen von den bürgerlichen Handwerker-Ständen einer mittelalterlichen Stadt gestellt wurden und etwa bis zum ersten Drittel des 17. Jahrhunderts eigene
pionier- und ingenieur-technischen Truppen von den bürgerlichen Handwerker-Ständen einer mittelalterlichen Stadt gestellt wurden und etwa bis zum ersten Drittel des 17. Jahrhunderts eigene
 Zünfte bildeten, hatten die Angehörigen dieser Gewerke anfänglich den Status von
Zünfte bildeten, hatten die Angehörigen dieser Gewerke anfänglich den Status von
 Nicht-Kombattanten. In dieser Tradition mittelalterlicher Zunft-Ordnungen begründet sich die Ausnahme, dass in der bald aufkommenden
Nicht-Kombattanten. In dieser Tradition mittelalterlicher Zunft-Ordnungen begründet sich die Ausnahme, dass in der bald aufkommenden  Truppen-Gattung der Artillerie auch Angehörige der bürgerlichen Stände ein reguläres Offiziers-Patent erhalten konnten. Truppen-Gattung der Artillerie auch Angehörige der bürgerlichen Stände ein reguläres Offiziers-Patent erhalten konnten.
Mit dem Aufkommen der
 "Stehenden Heere" nach dem Dreißigjährigen Krieg (siehe dazu
"Stehenden Heere" nach dem Dreißigjährigen Krieg (siehe dazu  WIKIPEDIA) wurde der Stück-Junker bzw. der Frei-Korporal der Artillerie mit einem WIKIPEDIA) wurde der Stück-Junker bzw. der Frei-Korporal der Artillerie mit einem
 Fahnen-Junker bzw. einem
Fahnen-Junker bzw. einem
 Fähnrich der
Fähnrich der
 Infanterie bzw. dem Standarten-Junker oder
Infanterie bzw. dem Standarten-Junker oder
 Kornett der
Kornett der
 Kavallerie gleichgestellt und rangierte damit bis 1807 als Offizier-Anwärter vor den
Kavallerie gleichgestellt und rangierte damit bis 1807 als Offizier-Anwärter vor den
 Unteroffizieren.
Unteroffizieren.
... zurück zum  Register Register
|
 Konstabler am Geschütz...
 Artillerist Ende 17. Jahrhundert...
Illustrationen von Anton Hoffmann in »Das deutsche Soldatenbuch« von Major a.D. Friedrich Wilhelm Deiss; Verlag A. Froehlich, Leipzig 1926.
(Quelle: eigene Sammlung)
|
STU
 Stück-Knechte beim Richten.
Le pointage (Das Zielen).
Abbildungen aus der 14-teiligen Serie »Les exercices militaires« (Militärische Übungen)
L'exercice du canon - Übungen an der Kanone von Jacques Callot (1592-1635)
(Quelle: ► »Bibliothèque nationale de France«)
|
Stück-Knecht
Im Unterschied zum  "Schneller", der in der frühen deutschen "Schneller", der in der frühen deutschen
 Artillerie (siehe dazu
Artillerie (siehe dazu  Arkeley) die groben Arbeiten an einem Arkeley) die groben Arbeiten an einem
 Wurf-Geschütz verrichtete und mit dem Aufkommen der
Wurf-Geschütz verrichtete und mit dem Aufkommen der
 Rohr-Waffen anfänglich auch hier schwere Lasten zu bewegen, zu heben und zu tragen hatte, war der Stück-Knecht ein spezialisiertes Mitglied einer eingespielten
Rohr-Waffen anfänglich auch hier schwere Lasten zu bewegen, zu heben und zu tragen hatte, war der Stück-Knecht ein spezialisiertes Mitglied einer eingespielten
 Geschütz-Bedienung mit einer konkreten Aufgabe (wobei ein guter
Geschütz-Bedienung mit einer konkreten Aufgabe (wobei ein guter  Stück-Meister Wert darauf legte, dass seine Stück-Meister Wert darauf legte, dass seine
 Kanoniere mit der Verrichtung sämtlicher Aufgaben vertraut und damit im Fall eines Ausfalls ersetzbar waren).
Kanoniere mit der Verrichtung sämtlicher Aufgaben vertraut und damit im Fall eines Ausfalls ersetzbar waren).
Zu diesen Aufgaben gehörte neben dem
 Auf- bzw. Abprotzen eines
Auf- bzw. Abprotzen eines
 lafetten-getragenen Geschützes vom Zug-Karren (bzw. der späteren Protze) die Bereitstellung der
lafetten-getragenen Geschützes vom Zug-Karren (bzw. der späteren Protze) die Bereitstellung der
 Munition und die Vorbereitung der
Munition und die Vorbereitung der
 Ladung sowie das Laden und Richten, Abfeuern und Reinigen des Geschütz-Rohres. Der Transport von Geschütz-Gespann, Munitions- und Pulver-Wagen, des
Ladung sowie das Laden und Richten, Abfeuern und Reinigen des Geschütz-Rohres. Der Transport von Geschütz-Gespann, Munitions- und Pulver-Wagen, des
 Artillerie-Trosses und häufig auch einer
Artillerie-Trosses und häufig auch einer
 Feld-Schmiede war Sache des
Feld-Schmiede war Sache des
 Fuhr-Meisters und seiner
Fuhr-Meisters und seiner
 Fuhr-Knechte. Die Er- und Einrichtung der
Fuhr-Knechte. Die Er- und Einrichtung der
 Geschütz-Stellung(en) samt mehreren
Geschütz-Stellung(en) samt mehreren
 Munitions-Bunkern wurde in der Regel von
Munitions-Bunkern wurde in der Regel von
 Schanz-Knechten erledigt, die diese Anlagen nach den Anweisungen des
Schanz-Knechten erledigt, die diese Anlagen nach den Anweisungen des
 Geschütz-Meisters bzw. -Führers errichteten.
Geschütz-Meisters bzw. -Führers errichteten.
Aufgrund der Vielzahl handwerklicher Gewerke, die vor -, während oder nach dem Einsatz der Artillerie als Bedienungs-, Wartungs- oder Instandsetzungs-Mannschaft im Zusammenspiel oder im Einzelnen zum Einsatz kamen, galt die Artillerie innerhalb des  mittelalterlichen mittelalterlichen
 Heeres-Wesens als eigene
Heeres-Wesens als eigene
 Zunft, deren Angehörige anfänglich den Status von
Zunft, deren Angehörige anfänglich den Status von
 "Nicht-Kombattanten" hatten und dem entsprechend nur in Ausnahmen in direkte bzw. persönlich ausgetragene
"Nicht-Kombattanten" hatten und dem entsprechend nur in Ausnahmen in direkte bzw. persönlich ausgetragene
 Nah- oder
Nah- oder  Zwei-Kämpfe verwickelt wurden. Zwei-Kämpfe verwickelt wurden.
Der sog. Stuckknecht-Spieß, der auf vielen Abbildungen dargestellt ist, hatte im
 Landsknechts-Heer mehr symbolische Bedeutung und zeichnete wahrscheinlich den Geschütz-Führer oder den
Landsknechts-Heer mehr symbolische Bedeutung und zeichnete wahrscheinlich den Geschütz-Führer oder den
 Wachhabenden des Arkeley-Lagers aus, das aufgrund des mitgeführten
Wachhabenden des Arkeley-Lagers aus, das aufgrund des mitgeführten
 Schieß-Pulvers abgetrennt vom eigentlichen
Schieß-Pulvers abgetrennt vom eigentlichen
 Feld-Lager errichtet wurde. In praktischer Verwendung dürfte dieser Spieß jedoch überwiegend die Funktion eines einfachen
Feld-Lager errichtet wurde. In praktischer Verwendung dürfte dieser Spieß jedoch überwiegend die Funktion eines einfachen
 Lunten-Spießes gehabt haben.
Lunten-Spießes gehabt haben.
... siehe dazu ausführlich  WIKIPEDIA WIKIPEDIA
... zurück zum  Register Register
|
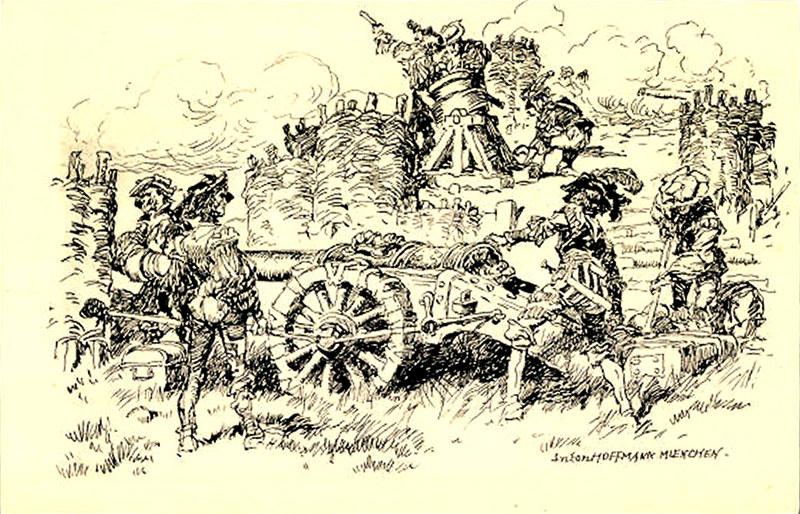 Stück-Knechte beim Laden einer Kanone (vorn) und eines Mörsers (hinten).
 Stück-Knecht mit Rohr-Wischer.
Postkarten aus einer Serie von Anton Hoffmann (1863-1938).
(Quelle ► eigene Sammlung)
|
STU
 Le tir (Das Schießen).
Abbildungen aus der 14-teiligen Serie »Les exercices militaires« (Militärische Übungen)
L'exercice du canon - Übungen an der Kanone von Jacques Callot (1592-1635)
(Quelle: ► »Bibliothèque nationale de France«)
 Das Richten zweier Geschütze
Holzschnitt von Erhard Schoen (1491-1542)
(Quelle: ► »zeno.org«)
 Freies Zielen über das Rohr einer "Falkana" (auch Halbe Schlange oder Falkonet; Gewicht ca. 600kg; Geschoss-Gewicht ca. 2,5kg).
 Zielen nach Augen-Maß über das Rohr einer "Halben Nothschlange" (auch Falke; Gewicht ca. 1.000kg; Geschoss-Gewicht ca. 3,5kg).
 Richten einer "Quartanschlange" (auch Quartierschlange; Gewicht ca. 1.250kg; Geschoss-Gewicht ca. 5kg) mittels eines Richt-Stabes.
 Richten einer großen "Quartanschlange" (auch große Quartierschlange; Gewicht ca. 1.500kg; Geschoss-Gewicht ca. 8kg) mittels eines Quadranten.
 Freies Zielen über das Rohr einer "Singerin" (Gewicht ca. 2.000kg; Geschoss-Gewicht ca. 10kg).
 Richten einer "Nachtigal" (Gewicht ca. 3.000kg; Geschoss-Gewicht ca. 25kg) mittels eines Visier-Stabes.
 Richten eines "Basiliseus" (Gewicht ca. 3.750kg; Geschoss-Gewicht ca. 35kg) mittels eines Quadranten.Illustrationen von Jost Amman (1539-1591) für das 3-teilige Werk »Kriegßbuch« von Leonhart Fronsperger (1520-1575); siehe dazu ► "Von Schantzen unnd Befestunngen...".
 "Die Beschießung der Burg Helfenstein im Jahr 1552"
Linksseitig der Stück-Meister, der seine gehobene Stellung zwar durch seine "zunft-mäßige" bzw. hochwertige Kleidung zur Schau stellen konnte, als Zivilist jedoch nicht berechtigt war, ein Schwert zu tragen.
Gemälde von Rudolf Staudenmaier im »Museum im Alten Bau« (Geislingen an der Steige; BW; GER).
(Quelle ► »Kunst- und Geschichtsverein Geislingen an der Steige e.V.«).
|
Stück-Meister
Als Stück- oder
 Büchsen-Meister wurden im
Büchsen-Meister wurden im
 spät-mittelalterlichen deutschen Raum ab der Mitte des 14. Jahrhunderts die fachkundigen Handwerker-Meister bezeichnet, die in der Herstellung aller Arten von
spät-mittelalterlichen deutschen Raum ab der Mitte des 14. Jahrhunderts die fachkundigen Handwerker-Meister bezeichnet, die in der Herstellung aller Arten von
 Geschütz vertraut waren. Da die Fertigung von Geschützen auch Erfahrungen im praktischen Umgang mit derartigen
Geschütz vertraut waren. Da die Fertigung von Geschützen auch Erfahrungen im praktischen Umgang mit derartigen  Waffen bedingte, wurden die Meister in der frühen deutschen Waffen bedingte, wurden die Meister in der frühen deutschen
 Artillerie (siehe dazu
Artillerie (siehe dazu  Arkeley) auch mit der Arkeley) auch mit der
 Geschütz-Führung von mindestens einer schweren
Geschütz-Führung von mindestens einer schweren
 Wurf- oder
Wurf- oder
 Rohr-Waffe betraut. Im Fall eines bewaffneten
Rohr-Waffe betraut. Im Fall eines bewaffneten
 Konflikts – vor allem im Rahmen einer
Konflikts – vor allem im Rahmen einer
 Belagerung – kommandierten die Stück- und/oder Büchsen-Meister innerhalb oder vor einer
Belagerung – kommandierten die Stück- und/oder Büchsen-Meister innerhalb oder vor einer
 Befestigung bzw. als Angehörige eines
Befestigung bzw. als Angehörige eines
 Heeres Geschütze verschiedenster Art und unterschiedlichstem
Heeres Geschütze verschiedenster Art und unterschiedlichstem
 Kaliber samt deren
Kaliber samt deren
 Bedienungs-Mannschaften. In der Regel gingen die Stück- oder Büchsen-Meister aus den früh-bürgerlichen Handwerker-Ständen der Zimmerer, Schreiner und Stellmacher und/oder (Glocken-) Gießer und Schmiede hervor, die innerhalb einer Stadt-Gesellschaft in abgegrenzten
Bedienungs-Mannschaften. In der Regel gingen die Stück- oder Büchsen-Meister aus den früh-bürgerlichen Handwerker-Ständen der Zimmerer, Schreiner und Stellmacher und/oder (Glocken-) Gießer und Schmiede hervor, die innerhalb einer Stadt-Gesellschaft in abgegrenzten
 Zünften organisiert waren (als Angehörige des sog.
Zünften organisiert waren (als Angehörige des sog.  "Antwerkes" bildeten die Stück- und Büchsen-Meister etwa ab dem 14. Jahrhundert eigene Zünfte: so nennen diverse Lexika des 19. Jahrhunderts bspw. die "Zunft der Blydner", die sich auf die Herstellung und Montage, Wartung und Bedienung schwerer "Antwerkes" bildeten die Stück- und Büchsen-Meister etwa ab dem 14. Jahrhundert eigene Zünfte: so nennen diverse Lexika des 19. Jahrhunderts bspw. die "Zunft der Blydner", die sich auf die Herstellung und Montage, Wartung und Bedienung schwerer
 Bliden spezialisiert hatten).
Bliden spezialisiert hatten).
Da die Herstellung, die Reparatur und Instandhaltung aber auch die einzelnen Abläufe zur Bedienung eines Geschützes eine Vielzahl handwerklicher Künste und Tätigkeiten erforderte, bildeten die Stück- und/oder Büchsen-Meister, die sich insbesondere dadurch auszeichneten, dass sie mit der Technik und der Bedienung, dem Leistungs-Spektrum aber auch den Besonderheiten "ihres
 Stückes" professionell vertraut waren, bald eine eigene Zunft, deren Mitglieder sich einem eigenen, selbst-verfassten Regel-Werk unterstellen. Gemäß der Tradition mittelalterlicher Zunft-Ordnungen hatten die Meister der Arkeley damit nicht nur das Recht, Gehilfen in den Dienst zu nehmen, die als
Stückes" professionell vertraut waren, bald eine eigene Zunft, deren Mitglieder sich einem eigenen, selbst-verfassten Regel-Werk unterstellen. Gemäß der Tradition mittelalterlicher Zunft-Ordnungen hatten die Meister der Arkeley damit nicht nur das Recht, Gehilfen in den Dienst zu nehmen, die als  Stück-Knechte die Geschütz-Bedienung stellten, sondern auch die Pflicht, Gesellen auszubilden und Lehr-Briefe auszustellen, die es dem Inhaber wiederum möglich machten, als Stück-Knechte die Geschütz-Bedienung stellten, sondern auch die Pflicht, Gesellen auszubilden und Lehr-Briefe auszustellen, die es dem Inhaber wiederum möglich machten, als  Stück-Junker eine Prüfung abzulegen; selbst zum Meister aufzusteigen oder die Nachfolge eines Meisters anzutreten (in dieser mittelalterlichen Zunft-Ordnung begründet sich die Ausnahme, dass in der bald aufkommenden Stück-Junker eine Prüfung abzulegen; selbst zum Meister aufzusteigen oder die Nachfolge eines Meisters anzutreten (in dieser mittelalterlichen Zunft-Ordnung begründet sich die Ausnahme, dass in der bald aufkommenden  Truppen-Gattung der Artillerie auch Angehörige der bürgerlichen Stände ein Truppen-Gattung der Artillerie auch Angehörige der bürgerlichen Stände ein
 Offiziers-Patent erhalten konnten).
Offiziers-Patent erhalten konnten).
Gegen Ende des 14. Jahrhunderts ist eine Abgrenzung in den Tätigkeits-Profilen eines Stück- und eines Büchsen-Meistern festzustellen: Spezialisierten sich die Büchsen-Meister mehr und mehr auf die Herstellung und Entwicklung von
 Feuer-Waffen und wurden sie aufgrund ihres technischen Sach-Verstandes vom Rat einer Stadt oder vom jeweiligen Regenten als
Feuer-Waffen und wurden sie aufgrund ihres technischen Sach-Verstandes vom Rat einer Stadt oder vom jeweiligen Regenten als
 Büchsen-Macher
Büchsen-Macher  "bestallt", waren die Stück-Meister zunehmend und gegen Ende des 15. Jahrhunderts ausschließlich für sämtliche "bestallt", waren die Stück-Meister zunehmend und gegen Ende des 15. Jahrhunderts ausschließlich für sämtliche
 taktisch-organisatorischen Bereiche zuständig und hatten damit vor allem die Verantwortung für die grundsätzliche Einsatz-Bereitschaft und damit den praktischen
taktisch-organisatorischen Bereiche zuständig und hatten damit vor allem die Verantwortung für die grundsätzliche Einsatz-Bereitschaft und damit den praktischen
 Einsatz der Geschütze. Der Stück-Meister befehligte die Montage, die Aufstellung und Ausrichtung seines Geschützes. Zusammen mit dem
Einsatz der Geschütze. Der Stück-Meister befehligte die Montage, die Aufstellung und Ausrichtung seines Geschützes. Zusammen mit dem
 Schanz-Meister beaufsichtigte er die Anlage der
Schanz-Meister beaufsichtigte er die Anlage der
 Stellung samt Einrichtung der/des
Stellung samt Einrichtung der/des
 Munitions-Depots. Bei mechanischen Wurf-Geschützen bestimmte er die Zuladung an Gegen-Gewichten durch die sog.
Munitions-Depots. Bei mechanischen Wurf-Geschützen bestimmte er die Zuladung an Gegen-Gewichten durch die sog.
 "Schneller"; bei pyrotechnischen Rohr-Geschützen die Menge der
"Schneller"; bei pyrotechnischen Rohr-Geschützen die Menge der
 Pulver-Ladung und die Art des
Pulver-Ladung und die Art des
 Geschosses. Er war für das Zielen bzw. Richten zuständig; er gab den Feuer-Befehl. Höchste Autorität und entsprechendes Ansehen besaß aufgrund seines Fach-Wissens, seiner Erfahrung und seines bewiesenen Könnens der
Geschosses. Er war für das Zielen bzw. Richten zuständig; er gab den Feuer-Befehl. Höchste Autorität und entsprechendes Ansehen besaß aufgrund seines Fach-Wissens, seiner Erfahrung und seines bewiesenen Könnens der
 Geschütz-Meister, der traditionell aus der Runde der Stück-Meister gewählt wurde. Zusammen mit dem
Geschütz-Meister, der traditionell aus der Runde der Stück-Meister gewählt wurde. Zusammen mit dem
 Wacht-Meister, der die
Wacht-Meister, der die
 Wachen der städtischen
Wachen der städtischen
 Spieß-Bürger kommandierte, und dem
Spieß-Bürger kommandierte, und dem
 Zeug-Meister, dem das
Zeug-Meister, dem das
 Zeug-Haus mit den hier eingelagerten
Zeug-Haus mit den hier eingelagerten
 Kriegs- und
Kriegs- und
 Rüst-Zeug unterstand, war der Geschütz-Meister für die Gewährleistung des
Rüst-Zeug unterstand, war der Geschütz-Meister für die Gewährleistung des
 militärischen Schutzes und der
militärischen Schutzes und der
 Verteidigung einer befestigten Stadt verantwortlich.
Verteidigung einer befestigten Stadt verantwortlich.
Im Fall einer
 kriegerischen Auseinandersetzung bzw. der Stellung eines
kriegerischen Auseinandersetzung bzw. der Stellung eines
 Aufgebots für das Heer des Landes-Fürsten hatten die Städte und Herrschaften festgesetzte
Aufgebots für das Heer des Landes-Fürsten hatten die Städte und Herrschaften festgesetzte
 Kontingente an "Zeug und Mannschaft" -,
Kontingente an "Zeug und Mannschaft" -,
 Reit- und Zug-Tieren,
Reit- und Zug-Tieren,
 Fuhr-Knechten und -Werken aufzubieten, wobei diese Dienste gemäß der mit den Landes-Ständen ausgehandelten und in (Miet-) Verträgen fixierten Konditionen zur
Fuhr-Knechten und -Werken aufzubieten, wobei diese Dienste gemäß der mit den Landes-Ständen ausgehandelten und in (Miet-) Verträgen fixierten Konditionen zur
 Landes-Defension
Landes-Defension
 besoldet wurden. Den Transport der Geschütze übernahmen mittels geeigneter Karren (ab dem 17. Jahrhundert dann
besoldet wurden. Den Transport der Geschütze übernahmen mittels geeigneter Karren (ab dem 17. Jahrhundert dann
 Lafetten und
Lafetten und
 Protzen) angeworbene Fuhr-Knechte, die von einem
Protzen) angeworbene Fuhr-Knechte, die von einem
 Fuhr- oder Geschirr-Meister geführt wurden. Munition und der zur Artillerie gehörende
Fuhr- oder Geschirr-Meister geführt wurden. Munition und der zur Artillerie gehörende
 Tross unterstanden dem
Tross unterstanden dem
 Zeug-Wart. Die Herstellung bzw. Bevorratung, Lagerung und Bereitstellung des Schiess-Pulvers oblag der Verantwortung des
Zeug-Wart. Die Herstellung bzw. Bevorratung, Lagerung und Bereitstellung des Schiess-Pulvers oblag der Verantwortung des
 Feuerwerker-Meisters, dessen Gehilfe(n) in der Regel auch die zur Zündung nötigen
Feuerwerker-Meisters, dessen Gehilfe(n) in der Regel auch die zur Zündung nötigen
 Lunten fertigten.
Lunten fertigten.
Obwohl die Stück-Meister samt ihren Bedienungs-Mannschaften anfänglich den Status von
 "Nicht-Kombattanten" hatten und dementsprechend nur in Ausnahmen in direkte bzw. persönlich ausgetragene
"Nicht-Kombattanten" hatten und dementsprechend nur in Ausnahmen in direkte bzw. persönlich ausgetragene
 Nah- oder
Nah- oder  Zwei-Kämpfe verwickelt wurden, hatte die städtische Vermietungs-Praxis die Folge, dass zahlreiche Meister unter den sich zuspitzenden konfessionellen und politischen Kontroversen im Streit um den wahren Glauben und die Vormacht im Reichs-Gebilde sich "selbstständig" machten und ihre Qualifikation und Profession samt ihrem Geschütz dauerhaft in den Zwei-Kämpfe verwickelt wurden, hatte die städtische Vermietungs-Praxis die Folge, dass zahlreiche Meister unter den sich zuspitzenden konfessionellen und politischen Kontroversen im Streit um den wahren Glauben und die Vormacht im Reichs-Gebilde sich "selbstständig" machten und ihre Qualifikation und Profession samt ihrem Geschütz dauerhaft in den
 Dienst eines der beiden Glaubens-Lager (Schmalkaldischer Bund; siehe dazu
Dienst eines der beiden Glaubens-Lager (Schmalkaldischer Bund; siehe dazu  WIKIPEDIA bzw. Nürnberger Liga; siehe dazu WIKIPEDIA bzw. Nürnberger Liga; siehe dazu  WIKIPEDIA) stellten. Als angestellte WIKIPEDIA) stellten. Als angestellte
 Artilleristen im
Artilleristen im
 Landsknechts-Heer unterstanden sie zwar dem
Landsknechts-Heer unterstanden sie zwar dem
 Befehl des
Befehl des
 Feldzeug-Meisters, genossen rechtlich, organisatorisch und finanziell jedoch eine Reihe von außergewöhnlichen Privilegien wie bspw. höhere Besoldung, bessere Verpflegung und eigene
Feldzeug-Meisters, genossen rechtlich, organisatorisch und finanziell jedoch eine Reihe von außergewöhnlichen Privilegien wie bspw. höhere Besoldung, bessere Verpflegung und eigene
 Disziplinar- und
Disziplinar- und
 Strafrechts-Ordnungen.
Strafrechts-Ordnungen.
Mit der zu dieser Zeit aufkommenden Unterscheidung von schweren
 Kanonen,
Kanonen,
 Haubitzen und
Haubitzen und
 Mörsern und immer leichteren
Mörsern und immer leichteren
 Büchsen bzw. der von Kaiser Maximilian (1459-1519; siehe dazu
Büchsen bzw. der von Kaiser Maximilian (1459-1519; siehe dazu  WIKIPEDIA) veranlassten Unterteilung der ihm gegebenen Artillerie nach Kaliber und dem davon abzuleitenden Geschoss-Gewicht entwickelte sich die Artillerie von einer WIKIPEDIA) veranlassten Unterteilung der ihm gegebenen Artillerie nach Kaliber und dem davon abzuleitenden Geschoss-Gewicht entwickelte sich die Artillerie von einer  Hilfs-Streitkraft mehr und mehr zu einer neuen Truppen-Gattung mit eigenen Hilfs-Streitkraft mehr und mehr zu einer neuen Truppen-Gattung mit eigenen
 Waffen-Gattungen wie bspw. der
Waffen-Gattungen wie bspw. der
 Kanoniere und
Kanoniere und
 Bombardiere. Damit einher ging auch die Herausbildung militärischer Hierarchien und
Bombardiere. Damit einher ging auch die Herausbildung militärischer Hierarchien und
 Rang-Klassen. In Anlehnung an die französischem Artillerie wandelte sich der Stück-Meister zum "Maître Cannonier", der dem Kommando eines bestallten
Rang-Klassen. In Anlehnung an die französischem Artillerie wandelte sich der Stück-Meister zum "Maître Cannonier", der dem Kommando eines bestallten
 Artillerie-Hauptmanns unterstand. Die Zusammenfassung mehrerer von ihm kommandierten Geschütze wurde – ebenfalls nach französischem Vorbild –
Artillerie-Hauptmanns unterstand. Die Zusammenfassung mehrerer von ihm kommandierten Geschütze wurde – ebenfalls nach französischem Vorbild –
 "Batterie" genannt. Und wurde der Stück-Meister in den deutschen
"Batterie" genannt. Und wurde der Stück-Meister in den deutschen  Armeen zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert vom Armeen zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert vom  Konstabler, Feuerwerks- oder Wacht-Meister verdrängt, tauchte die Bezeichnung gegen Ende des 19. Jahrhunderts in der Kaiserlichen Deutschen Marine wieder auf ging auf einen Konstabler, Feuerwerks- oder Wacht-Meister verdrängt, tauchte die Bezeichnung gegen Ende des 19. Jahrhunderts in der Kaiserlichen Deutschen Marine wieder auf ging auf einen
 Unteroffizier im
Unteroffizier im
 Feldwebel-Rang über, der unter dem Kommando eines Geschütz-Meisters auf
Feldwebel-Rang über, der unter dem Kommando eines Geschütz-Meisters auf
 Linien-Schiffen oder
Linien-Schiffen oder
 Kreuzern als Geschütz-Führer die Bedienung eines schweren Zwillings- oder Drillings- Geschützes bzw. eines
Kreuzern als Geschütz-Führer die Bedienung eines schweren Zwillings- oder Drillings- Geschützes bzw. eines
 Geschütz-Turmes befehligte.
Geschütz-Turmes befehligte.
... siehe dazu ausführlich  WIKIPEDIA WIKIPEDIA
... zurück zum  Register Register
... Buch-Empfehlungen:
 »Zeugbuch Kaiser Maximilians I.« »Zeugbuch Kaiser Maximilians I.«
Inventar-Verzeichnis des kaiserlichen Arsenals, illustriert von Jörg Kölderer; Innsbruck um 1502; vollständige Ausgabe in der Digitalen Sammlung der Bayerischen Staatsbibliothek.
 »Vortrab zu der Arckalay.« »Vortrab zu der Arckalay.«
Feuerwerker-, Büchsenmeister und Artillerie-Buch von Walther Litzelmann; Ingoldstadt, 1582; vollständige Ausgabe in der Digitalen Sammlung der Bayerischen Staatsbibliothek.
 »Neuwe geometrische Büchsenmeisterey.« »Neuwe geometrische Büchsenmeisterey.«
Fach-Buch von Leonhard Zubler; Zürich 1608; vollständige Ausgabe in der Digitalen Sammlung der Bayerischen Staatsbibliothek.
 »Neue curieuse Beschreibung Der gantzen Artillerie.« »Neue curieuse Beschreibung Der gantzen Artillerie.«
Fach-Buch von Michael Miethen; Dresden - Leipzig 1736; vollständige Ausgabe in der Digitalen Sammlung der Bayerischen Staatsbibliothek.
... insbesondere das »Kriegßbuch« von Leonhart Fronsperger (1520-1575), Franckfurt am Mayn, 1573; in der Digitalen Sammlung der Bayerischen Staatsbibliothek:
Teil 1:  "Von Kayserlichen Kriegß-Rechten..." "Von Kayserlichen Kriegß-Rechten..."
Teil 2:  "Von Wagenburgk umd die Feldleger..." "Von Wagenburgk umd die Feldleger..."
Teil 3:  "Von Schantzen unnd Befestunngen..." "Von Schantzen unnd Befestunngen..."
|
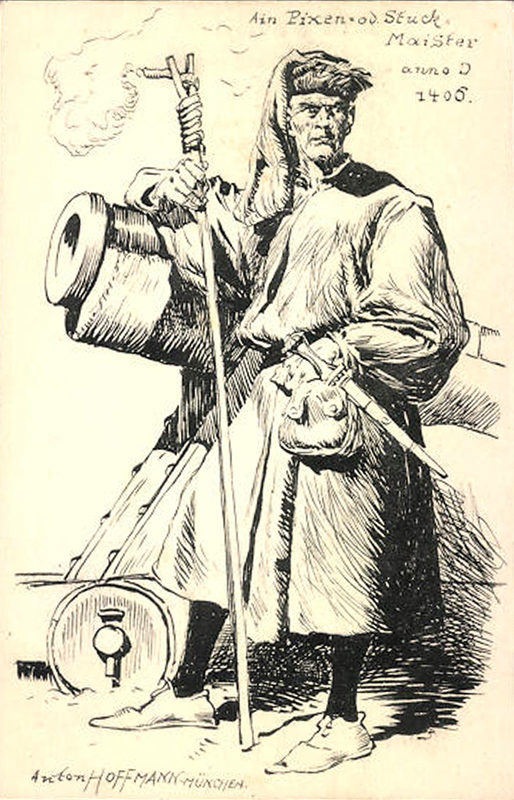 »Ain Pixen- oder Stück-Maister anno D 1406«
Abbildung aus einer Postkarten-Serie von Anton Hoffmann (1863-1938).
(Quelle ► eigene Sammlung)
 Büchsenmeister
Abbildung aus der Serie: »Heereszug der Landsknechte« von Erhard Schoen (1491-1542)
(Quelle: ► »zeno.org«)
 "Constabel u. Bombardire"
Stich von Christoph Weigel (1654-1725)
(Quelle: ► »Deutsche Fotothek.«)
 Werkzeug, Waffe und Status-Symbol des Stück-Meisters:
♦ Ital. Lunten-Spieß. 17. Jhd.
♦ Preuss, Lunten-Spieß, 1720.
♦ Engl. Linstock, 16.Jhd.
♦ Lunten-Spieß. 18. Jhd.
♦ Büchsenmeister-Luntenspieß, zweite Hälfte 16. Jhd.
Abbildungen aus dem "Handbuch der Waffenkunde" von Wendelin Boeheim; Verlag E.A. Seemann, Leipzig, 1890;
(online verfügbar im: ► »Deutschen Textarchiv«)
 Stückmeister an Land
Abbildung Nr. 28 aus der Waldorf-Astoria-Zigarettenbilder-Serie »Uniformen der Marine und Schutztruppen«
(Quelle: befreundeter Sammler)
|
SUB |
Subaltern-Offiziere (auch Junior oder Feld-Offiziere)
(engl.: Junior oder Company Officer; russ.: Субалтерн-офицер)
Als Subaltern-Offiziere (lat.: "subalternus"; untergeordnet, von niederem Rang oder auch "sub alter"; unter einem) wurden in der  Armee des Armee des
 Deutschen Reiches sämtliche
Deutschen Reiches sämtliche
 Offiziere bezeichnet, die als Gehilfen eines
Offiziere bezeichnet, die als Gehilfen eines
 Kompanie-,
Kompanie-,  Eskadrons- oder Eskadrons- oder
 Batterie-Chefs dienten, jedoch keine eigene
Batterie-Chefs dienten, jedoch keine eigene
 Befehls- und Straf-Gewalt inne hatten (siehe dazu
Befehls- und Straf-Gewalt inne hatten (siehe dazu
 Disziplin). Die
Disziplin). Die
 Dienstgrad-Gruppe der Subaltern-Offiziere stand zwischen den
Dienstgrad-Gruppe der Subaltern-Offiziere stand zwischen den
 Unteroffizieren und den
Unteroffizieren und den
 Stabsoffizieren. Zu ihnen gehörten:
Stabsoffizieren. Zu ihnen gehörten:
… sowie Hauptleute ohne Kommando:
Etwa zur Mitte des 17. Jahrhunderts wurden die Offiziere der
 französischen Armee in nachgeordnete
französischen Armee in nachgeordnete
 Rang-Klassen unterteilt, die die
Rang-Klassen unterteilt, die die
 Kommando-Hierarchie und damit die Befehls-Gebung bzw. die damit verbundenen -Gewalten eindeutig regelten: Dem König als obersten Befehlshaber direkt unterstellt war die
Kommando-Hierarchie und damit die Befehls-Gebung bzw. die damit verbundenen -Gewalten eindeutig regelten: Dem König als obersten Befehlshaber direkt unterstellt war die
 strategische Ebene der
strategische Ebene der
 "Officiers Généraux", die wiederum das Kommando über die
"Officiers Généraux", die wiederum das Kommando über die
 operative Ebene der "Officiers supérieurs" ausübten. Ausgeführt wurden die Befehle in der Regel von der
operative Ebene der "Officiers supérieurs" ausübten. Ausgeführt wurden die Befehle in der Regel von der
 taktischen Ebene der "Officiers Subalterne", die zu diesem Zweck ein Kommando bzw. eine Anweisung erhielten.
taktischen Ebene der "Officiers Subalterne", die zu diesem Zweck ein Kommando bzw. eine Anweisung erhielten.
Nach dem Dreißigjährigen Krieg (siehe dazu  WIKIPEDIA) bzw. mit der Errichtung der s.g. WIKIPEDIA) bzw. mit der Errichtung der s.g.
 "Stehenden Heere" wurde die Einteilung in Generalität, Stabs- und Subaltern-Offiziere auch in den
"Stehenden Heere" wurde die Einteilung in Generalität, Stabs- und Subaltern-Offiziere auch in den  Heeren übernommen, wobei hier anfänglich nur die Leutnante (früher Leutnants) und Fähnriche – häufig Offiziers-Anwärter – im Kompanie-Dienst subaltern gestellt und mit der Führung der einzelnen Heeren übernommen, wobei hier anfänglich nur die Leutnante (früher Leutnants) und Fähnriche – häufig Offiziers-Anwärter – im Kompanie-Dienst subaltern gestellt und mit der Führung der einzelnen  Züge beauftragt wurden. Mit der Abschaffung der Züge beauftragt wurden. Mit der Abschaffung der
 Kompanie-Wirtschaft im Rahmen der
Kompanie-Wirtschaft im Rahmen der
 Militär-Reformen von 1807 wurden die Stabs-Hauptleute, die die Kompanie bis dahin in Stellvertretung bzw. im Auftrag des Kompanie-Chefs befehligten, überflüssig; nach anfänglichen Widerständen wurde nunmehr die Hauptmannschaft ebenfalls den Subaltern-Offizieren zugeordnet.
Militär-Reformen von 1807 wurden die Stabs-Hauptleute, die die Kompanie bis dahin in Stellvertretung bzw. im Auftrag des Kompanie-Chefs befehligten, überflüssig; nach anfänglichen Widerständen wurde nunmehr die Hauptmannschaft ebenfalls den Subaltern-Offizieren zugeordnet.
In den deutschen Armeen nach 1945 war der Begriff offiziell nicht mehr im Gebrauch.
... siehe dazu ausführlich  WIKIPEDIA WIKIPEDIA
... zurück zum  Register Register
|
 |
|











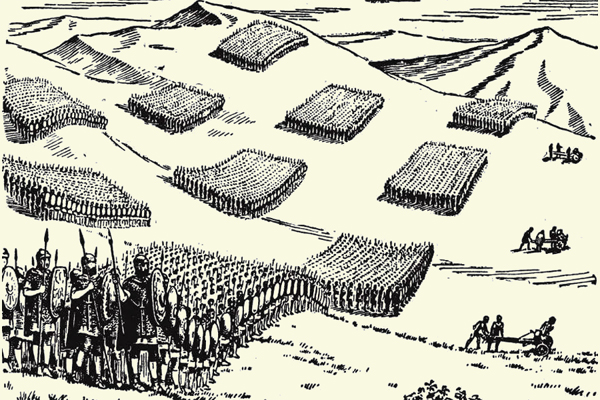
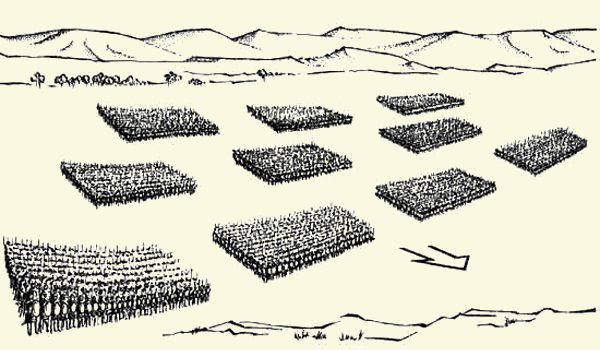
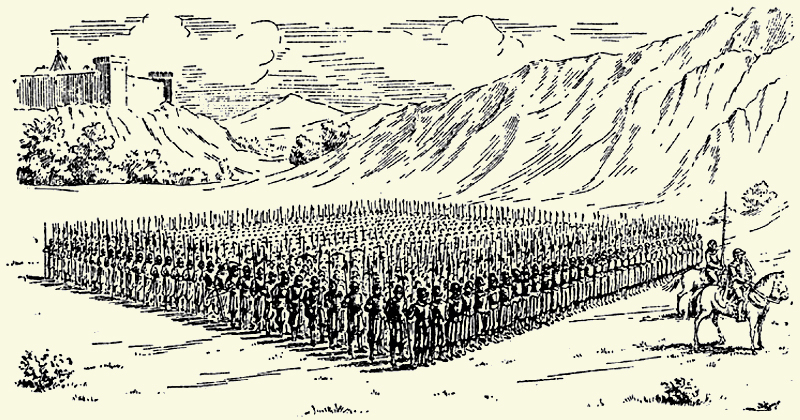
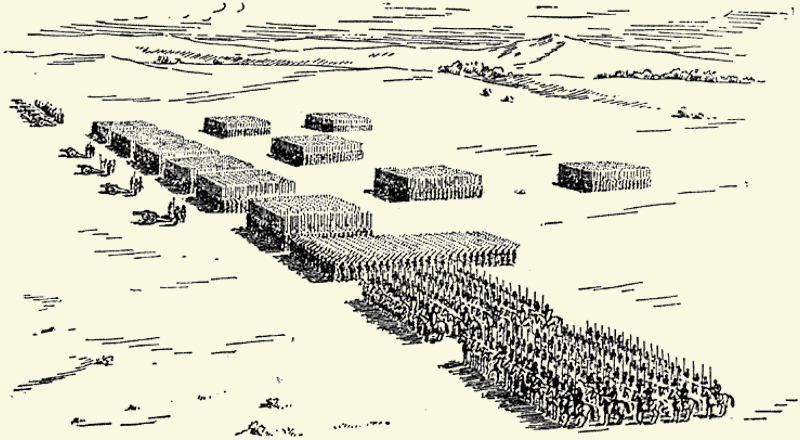
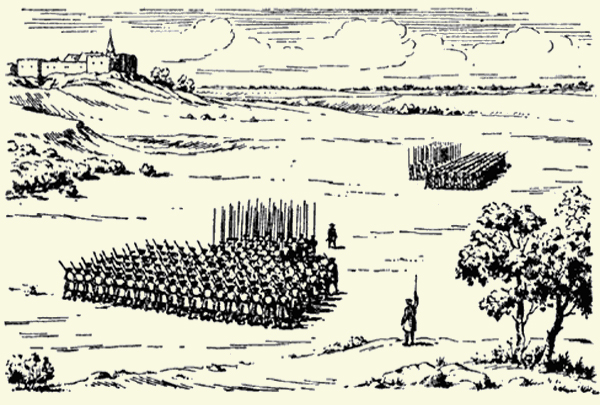
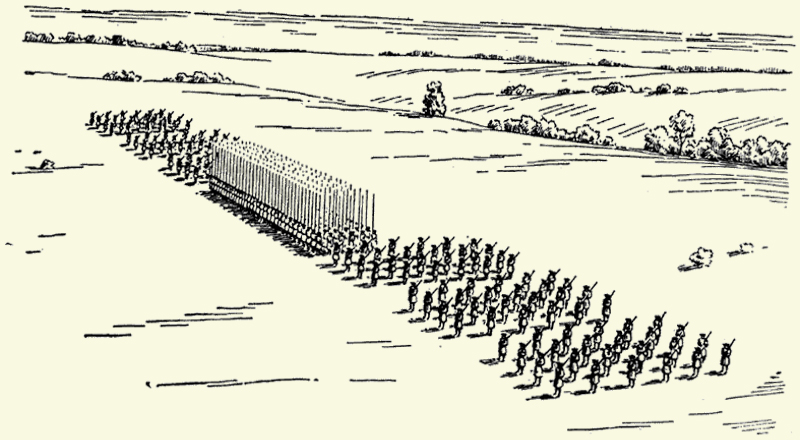
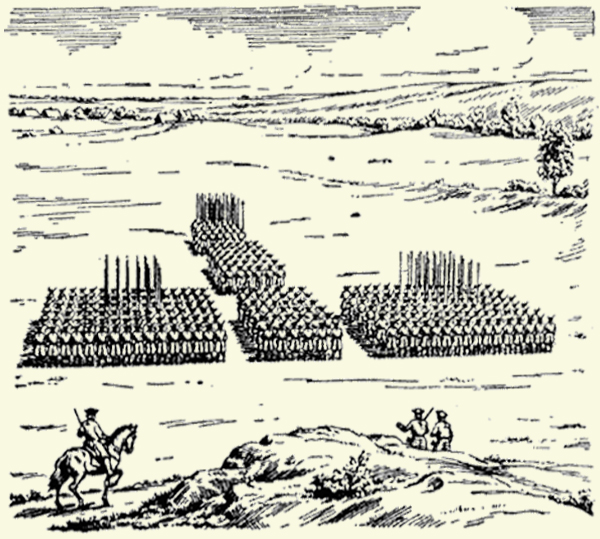

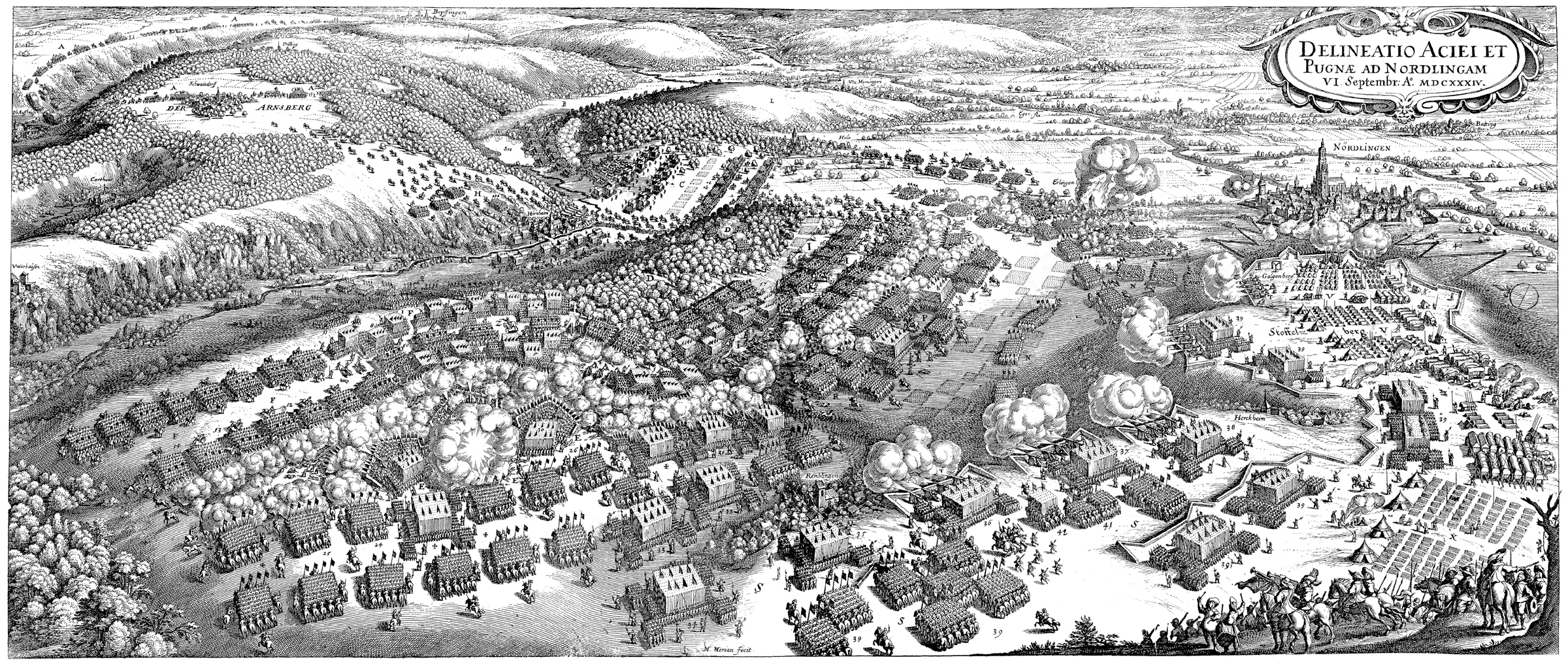






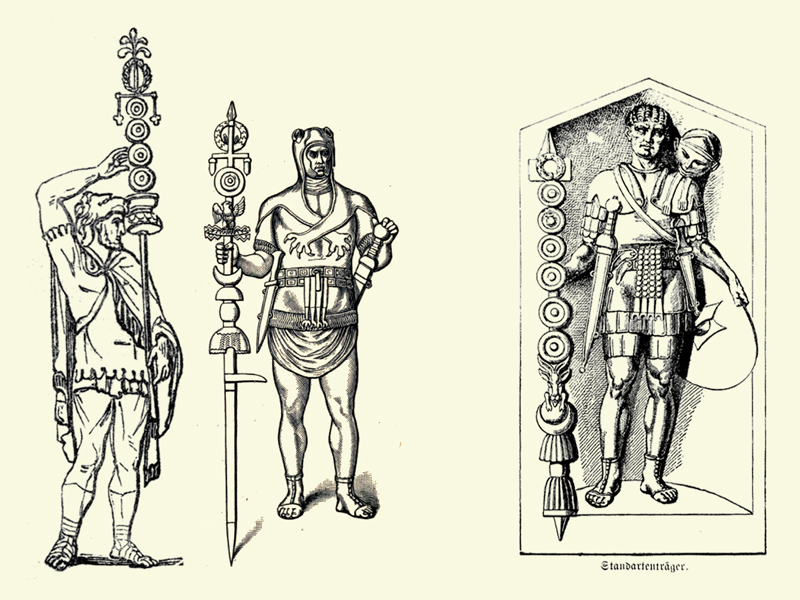


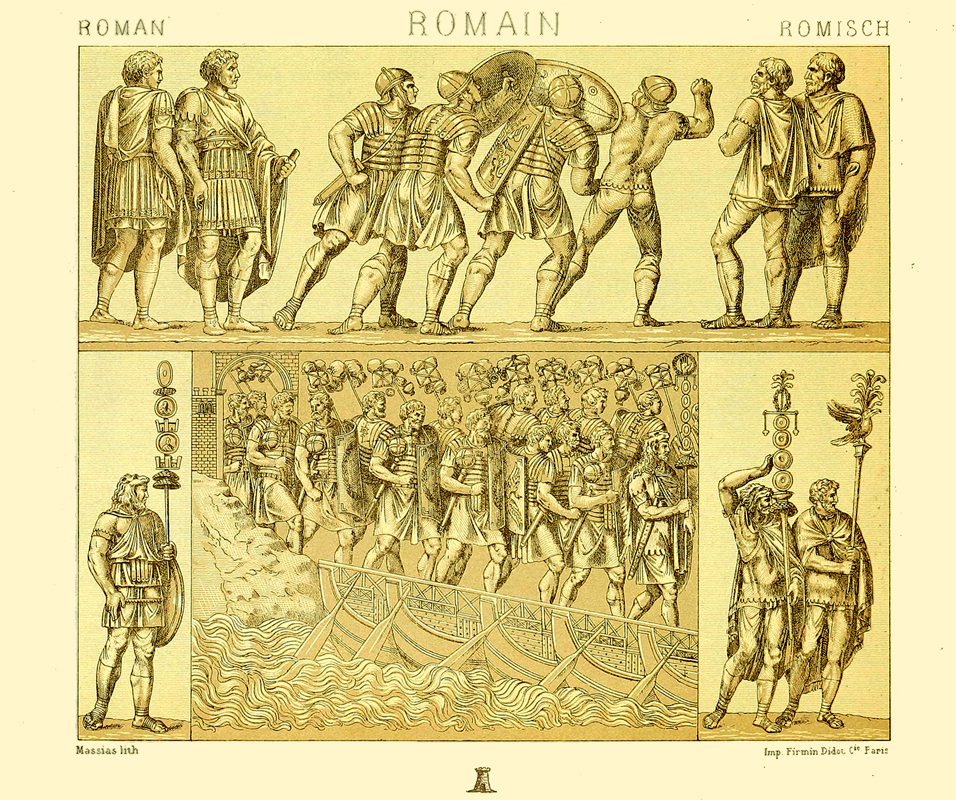


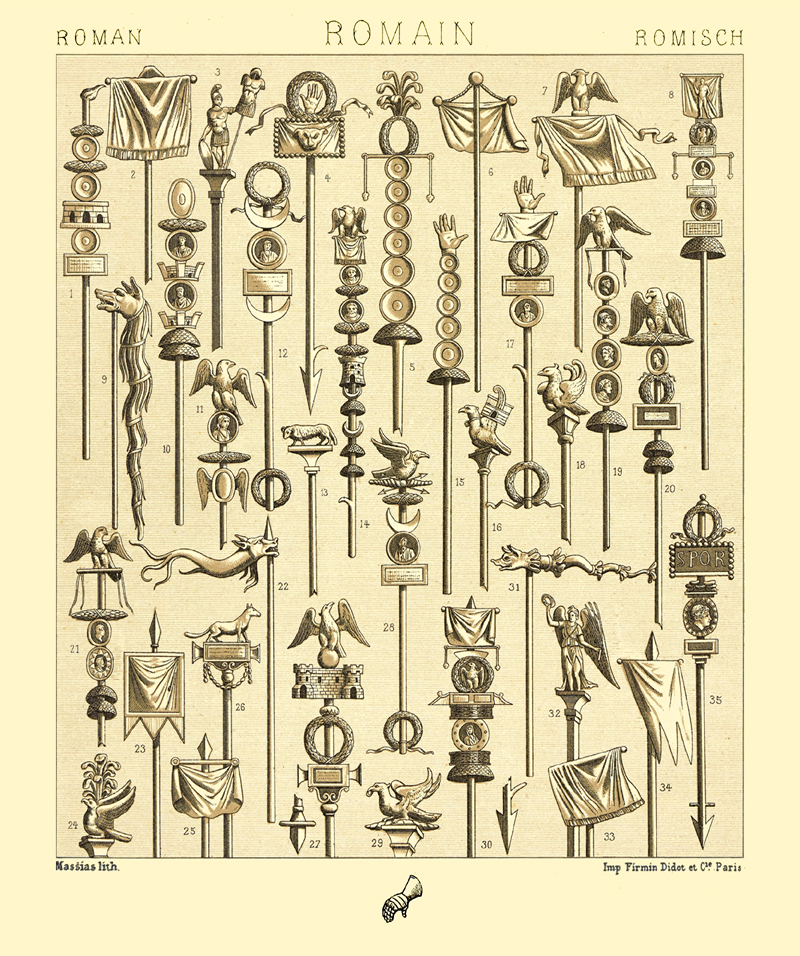







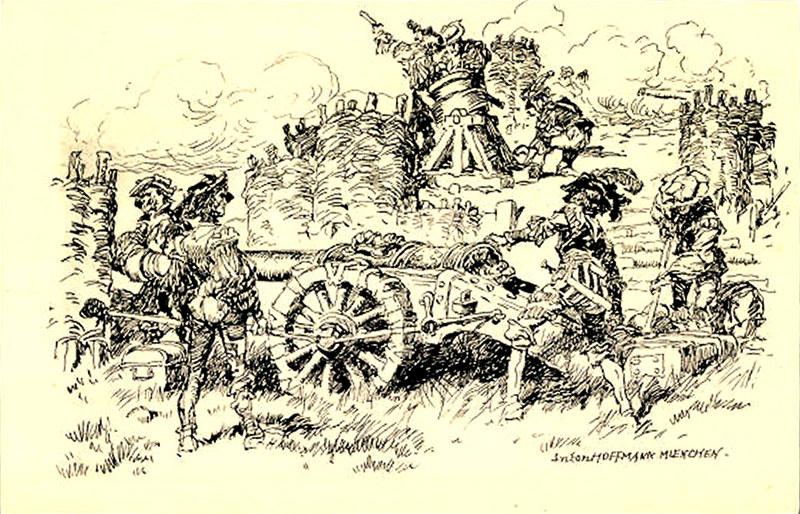


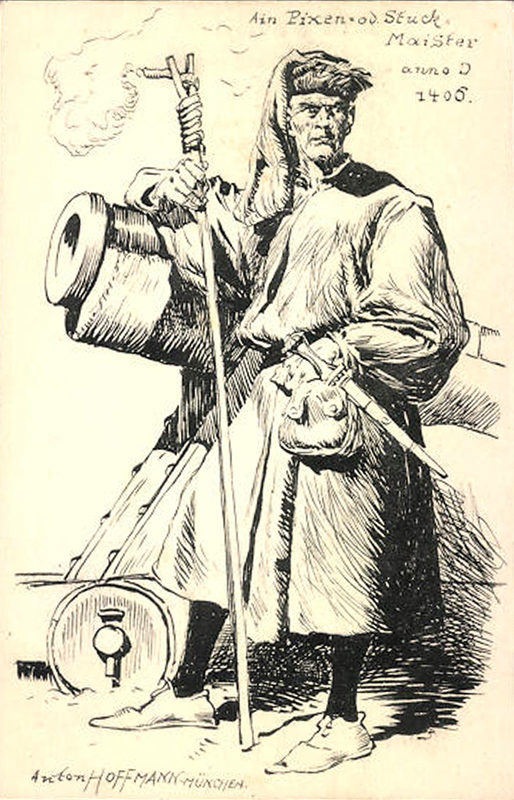


 äbel bis
äbel bis